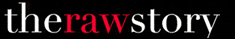Wie linke Medien aus der Krise Kapital schlagen – oder auch nicht.
Felix Werdermann - Alternativen sind gefragt, gerade in Krisenzeiten. Eigentlich – so müsste man meinen – ein Glücksfall für linke Medien. Denn wenn jemand Alternativen präsentieren kann, dann sind sie es. Trotzdem profitieren sie nicht von der Krise.
Täglich kommen neue Meldungen über die Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Täglich verschärft sich die Situation. Und täglich steigt das Bedürfnis, die Krise zu verstehen und Alternativen zu kennen. Dennoch schaffen es die linken Medien nicht, aus der Krise Kapital zu schlagen. Die Auflagenzahlen stagnieren. Zumindest in dem Punkt sind sich die Diskutanten einig. Sie müssen es wissen, denn auf dem Podium sitzen die Ex- und Chefredakteure der linken Zeitungen in Deutschland: taz, Neues Deutschland, Frankfurter Rundschau und Freitag.

Die Linke Medienakademie lädt zur Diskussion
Eingeladen hatten die Linke Medienakademie und die Genossenschaft der Tageszeitung taz. Das taz-Café unter den Redaktionsräumen der taz ist gut gefüllt, alle Stühle sind besetzt; einige Menschen stehen am Tresen, an dem mittags die taz-Redakteurinnen und –Redakteure ihr Mittagessen bestellen. Im Publikum sind hauptsächlich Journalistinnen und Journalisten – Leute, die tagtäglich mit linken Medien zu tun haben oder den Anspruch haben, linken Journalismus zu machen.
„Wir haben es immer schon gewusst und gesagt“
Am Donnerstagabend geht es um die Krise. Betroffen sind vor allem die Medien, die sich größtenteils aus Anzeigen finanzieren. Bei linken Medien ist das anders. Aber auch wenn sie nicht so sehr unter der Krise leiden, profitieren sie auch nicht von ihr. Warum, das weiß auf dem Podium niemand so recht. Bascha Mika, langjährige Chefredakteurin der taz, wagt einen Erklärungsversuch: „Man kommt schnell rechthaberisch daher“, sagt sie. Man müsse sich „sofort vom Standpunkt befreien: Wir haben es immer schon gewusst und gesagt“. Dabei treffe dies manchmal durchaus zu – beispielsweise beim Klimawandel. Heute könne die taz „mit Fug und Recht“ behaupten: „Leute ihr habt was begriffen, was wir seit 29 Jahren erzählt haben“ – so lange gibt es die taz.
Und seit Anfang an macht die taz Erfahrung mit der Finanzkrise – allerdings im eigenen Hause: Ständig startet die taz neue Werbekampagnen, die Lesenden werden um Spenden gebeten – und immer heißt es, die taz stehe kurz vor dem Ende. Heute wirbt sie selbst damit: „Wenn jemand fundiert über Finanzkrisen berichten kann, dann ja wohl wir“.
Verbreitung und Ansehen steigt
Neue Leserinnen und Leser hat die taz aber durch die Finanzkrise nicht gewonnen. Profitiert haben könnte sie dennoch – sagt zumindest Wolfgang Storz, ehemaliger Chefredakteur der Frankfurter Rundschau (FR). Es sei ein „Fehler, wenn wir Erfolg an der Auflage messen“, sagt er. Rein wirtschaftlich definierten Erfolg – den „kann man sich abschminken“. Dafür könnten Texte aus linken Medien stark verbreitet werden und viel bewirken. Dadurch steige auch das Ansehen der Autorin oder des Autors.
Jürgen Reents, Chefredakteur beim Neuen Deutschland (ND), hält dagegen: Die Auflage müsse ein Gradmesser für den Erfolg der Zeitungen sein. Ohne Geld stelle sich die „Frage, ob Qualitäts-Journalismus möglich ist“. Doch Geld ist nicht alles: Das ND bezeichnet sich schließlich als sozialistische Tageszeitung. „Wir betreiben meinungsorientierten Journalismus“, sagt Reents. Dabei bemühe sich das ND stets um den „Blick von unten“ und um das Aufzeigen von „Alternativen zum Kapitalismus“.
Eigentlich müsste das ND ist in Krisenzeiten eine gefragte Zeitung sein. Doch die Auflage geht seit Jahren zurück – viele Menschen lesen das ehemalige Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) schon seit vielen Jahren, neue junge Leserinnen und Leser lassen sich kaum finden. Dabei sei das ND heute keinesfalls so staatstreu wie in DDR-Zeiten, beteuert Reents. „Heute ist die Zeitung oppositionell.“
„Die Zeitungen gehören in die Mitte“
Die taz hingegen hat sich in die andere Richtung entwickelt: „Alle Zeitungen sind ein Stück weit in die Mitte gerückt“, sagt Chefredakteurin Bascha Mika. „Da gehören sie auch hin, denn dort werden die Themen diskutiert.“ Storz, ehemaliger Chefredakteur der FR, sieht das kritischer: „Natürlich sollten linke Medien in die Mitte, dadurch dass sie eine Vier-Millionen-Auflage haben“ – aber die inhaltliche Ausrichtung dürfe dafür nicht geopfert werden.
Aber für Storz zählen nicht nur Perspektive und Themengewichtung. „Ein linkes Medium muss verständlich sein. Das kling banal, aber ich als Leser verstehe vieles nicht.“ Außerdem sollten linke Medien möglichst konkret berichten, zum Beispiel ob die Regierung ihr Anti-Krisen-Programm bei der Deutschen Bank abschreibt. „Ich will wissen, was ist.“ Die Analyse sei die Hauptaufgabe linker Medien.
Antworten auf die Wirtschaftskrise sollen sie aber nicht liefern, „das ist Aufgabe von Parteien und der Zivilgesellschaft“. Sofort meldet Philip Grassmann „fundamentalen Dissens“ an: Die Medien hätten ebenfalls die Aufgabe, Antworten zu geben, sagt der neue Chefredakteur der Wochenzeitung Freitag. „Man unterschätzt das Bedürfnis an Orientierung.“ Informationen alleine reichten nicht, linke Medien müssten auch sagen, was sie bedeuten.
Bei der Finanzkrise herrscht Ratlosigkeit
Bei der Finanzkrise scheint sich das allerdings schwierig zu gestalten. Hier herrscht auch in den linken Medien meist Ratlosigkeit. taz-Chefin Bascha Mika sagt: „Eines der Hauptprobleme der Linken ist, dass sie zu oft glaubt, sie habe Antworten.“ Tatsächlich habe der Neoliberalismus „verbrannte Erde hinterlassen“: Linke Konzepte seien nicht weiterentwickelt worden. Jetzt müsse man das „Brachland neu bestellen“.
Aber wie? Jürgen Reents vom ND schlägt vor, Ressourcen zusammenzulegen. Für Fusionen seien die Zeitungen zwar zu verschieden, aber man könne darüber nachdenken, eine gemeinsame Online-Plattform einzurichten. Das sei ein „Vorschlag, den wir in allen Zeitungen diskutieren sollten.“
Mögliche Kooperationen
Vielleicht hilft ja auch zunächst ein Austausch untereinander über mögliche Kooperationen. Bei den kleinen linken Zeitungsprojekten gibt es dafür die Linke Medienakademie. Dort können sich Macherinnen und Macher linker Medien kennen lernen, sich austauschen und voneinander lernen. Bei den großen Zeitungen müsste das doch auch möglich sein.
 Felix Werdermann, geboren 1988, lebt in Berlin und studiert dort Politikwissenschaft und Mathematik. Er ist in unterschiedlichen politischen Zusammenhängen aktiv und schreibt für verschiedene Zeitungen, u.a. für die Jugendzeitung "utopia".
Felix Werdermann, geboren 1988, lebt in Berlin und studiert dort Politikwissenschaft und Mathematik. Er ist in unterschiedlichen politischen Zusammenhängen aktiv und schreibt für verschiedene Zeitungen, u.a. für die Jugendzeitung "utopia".
Täglich kommen neue Meldungen über die Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Täglich verschärft sich die Situation. Und täglich steigt das Bedürfnis, die Krise zu verstehen und Alternativen zu kennen. Dennoch schaffen es die linken Medien nicht, aus der Krise Kapital zu schlagen. Die Auflagenzahlen stagnieren. Zumindest in dem Punkt sind sich die Diskutanten einig. Sie müssen es wissen, denn auf dem Podium sitzen die Ex- und Chefredakteure der linken Zeitungen in Deutschland: taz, Neues Deutschland, Frankfurter Rundschau und Freitag.

Die Linke Medienakademie lädt zur Diskussion
Eingeladen hatten die Linke Medienakademie und die Genossenschaft der Tageszeitung taz. Das taz-Café unter den Redaktionsräumen der taz ist gut gefüllt, alle Stühle sind besetzt; einige Menschen stehen am Tresen, an dem mittags die taz-Redakteurinnen und –Redakteure ihr Mittagessen bestellen. Im Publikum sind hauptsächlich Journalistinnen und Journalisten – Leute, die tagtäglich mit linken Medien zu tun haben oder den Anspruch haben, linken Journalismus zu machen.
„Wir haben es immer schon gewusst und gesagt“
Am Donnerstagabend geht es um die Krise. Betroffen sind vor allem die Medien, die sich größtenteils aus Anzeigen finanzieren. Bei linken Medien ist das anders. Aber auch wenn sie nicht so sehr unter der Krise leiden, profitieren sie auch nicht von ihr. Warum, das weiß auf dem Podium niemand so recht. Bascha Mika, langjährige Chefredakteurin der taz, wagt einen Erklärungsversuch: „Man kommt schnell rechthaberisch daher“, sagt sie. Man müsse sich „sofort vom Standpunkt befreien: Wir haben es immer schon gewusst und gesagt“. Dabei treffe dies manchmal durchaus zu – beispielsweise beim Klimawandel. Heute könne die taz „mit Fug und Recht“ behaupten: „Leute ihr habt was begriffen, was wir seit 29 Jahren erzählt haben“ – so lange gibt es die taz.
Und seit Anfang an macht die taz Erfahrung mit der Finanzkrise – allerdings im eigenen Hause: Ständig startet die taz neue Werbekampagnen, die Lesenden werden um Spenden gebeten – und immer heißt es, die taz stehe kurz vor dem Ende. Heute wirbt sie selbst damit: „Wenn jemand fundiert über Finanzkrisen berichten kann, dann ja wohl wir“.
Verbreitung und Ansehen steigt
Neue Leserinnen und Leser hat die taz aber durch die Finanzkrise nicht gewonnen. Profitiert haben könnte sie dennoch – sagt zumindest Wolfgang Storz, ehemaliger Chefredakteur der Frankfurter Rundschau (FR). Es sei ein „Fehler, wenn wir Erfolg an der Auflage messen“, sagt er. Rein wirtschaftlich definierten Erfolg – den „kann man sich abschminken“. Dafür könnten Texte aus linken Medien stark verbreitet werden und viel bewirken. Dadurch steige auch das Ansehen der Autorin oder des Autors.
Jürgen Reents, Chefredakteur beim Neuen Deutschland (ND), hält dagegen: Die Auflage müsse ein Gradmesser für den Erfolg der Zeitungen sein. Ohne Geld stelle sich die „Frage, ob Qualitäts-Journalismus möglich ist“. Doch Geld ist nicht alles: Das ND bezeichnet sich schließlich als sozialistische Tageszeitung. „Wir betreiben meinungsorientierten Journalismus“, sagt Reents. Dabei bemühe sich das ND stets um den „Blick von unten“ und um das Aufzeigen von „Alternativen zum Kapitalismus“.
Eigentlich müsste das ND ist in Krisenzeiten eine gefragte Zeitung sein. Doch die Auflage geht seit Jahren zurück – viele Menschen lesen das ehemalige Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) schon seit vielen Jahren, neue junge Leserinnen und Leser lassen sich kaum finden. Dabei sei das ND heute keinesfalls so staatstreu wie in DDR-Zeiten, beteuert Reents. „Heute ist die Zeitung oppositionell.“
„Die Zeitungen gehören in die Mitte“
Die taz hingegen hat sich in die andere Richtung entwickelt: „Alle Zeitungen sind ein Stück weit in die Mitte gerückt“, sagt Chefredakteurin Bascha Mika. „Da gehören sie auch hin, denn dort werden die Themen diskutiert.“ Storz, ehemaliger Chefredakteur der FR, sieht das kritischer: „Natürlich sollten linke Medien in die Mitte, dadurch dass sie eine Vier-Millionen-Auflage haben“ – aber die inhaltliche Ausrichtung dürfe dafür nicht geopfert werden.
Aber für Storz zählen nicht nur Perspektive und Themengewichtung. „Ein linkes Medium muss verständlich sein. Das kling banal, aber ich als Leser verstehe vieles nicht.“ Außerdem sollten linke Medien möglichst konkret berichten, zum Beispiel ob die Regierung ihr Anti-Krisen-Programm bei der Deutschen Bank abschreibt. „Ich will wissen, was ist.“ Die Analyse sei die Hauptaufgabe linker Medien.
Antworten auf die Wirtschaftskrise sollen sie aber nicht liefern, „das ist Aufgabe von Parteien und der Zivilgesellschaft“. Sofort meldet Philip Grassmann „fundamentalen Dissens“ an: Die Medien hätten ebenfalls die Aufgabe, Antworten zu geben, sagt der neue Chefredakteur der Wochenzeitung Freitag. „Man unterschätzt das Bedürfnis an Orientierung.“ Informationen alleine reichten nicht, linke Medien müssten auch sagen, was sie bedeuten.
Bei der Finanzkrise herrscht Ratlosigkeit
Bei der Finanzkrise scheint sich das allerdings schwierig zu gestalten. Hier herrscht auch in den linken Medien meist Ratlosigkeit. taz-Chefin Bascha Mika sagt: „Eines der Hauptprobleme der Linken ist, dass sie zu oft glaubt, sie habe Antworten.“ Tatsächlich habe der Neoliberalismus „verbrannte Erde hinterlassen“: Linke Konzepte seien nicht weiterentwickelt worden. Jetzt müsse man das „Brachland neu bestellen“.
Aber wie? Jürgen Reents vom ND schlägt vor, Ressourcen zusammenzulegen. Für Fusionen seien die Zeitungen zwar zu verschieden, aber man könne darüber nachdenken, eine gemeinsame Online-Plattform einzurichten. Das sei ein „Vorschlag, den wir in allen Zeitungen diskutieren sollten.“
Mögliche Kooperationen
Vielleicht hilft ja auch zunächst ein Austausch untereinander über mögliche Kooperationen. Bei den kleinen linken Zeitungsprojekten gibt es dafür die Linke Medienakademie. Dort können sich Macherinnen und Macher linker Medien kennen lernen, sich austauschen und voneinander lernen. Bei den großen Zeitungen müsste das doch auch möglich sein.
sfux - 25. Feb, 08:27 Article 4329x read