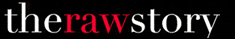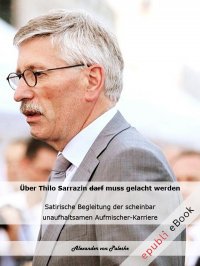Der zerbrochene Spiegel
Lukas Vogelsang - Es gibt eine Stadt im Vorreich von Zürich, zwischen den Seen und Bergen, unweit von hier. Sie heisst Bern. Wir finden sie auf fast keiner Landkarte, doch wenn wir auf unserer Reise zwischen Genf und Zürich eine Atempause einlegen, so sind wir bereits da. Es ist eine Stadt voller lustiger und artiger Gesellen, Frauen und Kinder. Sie arbeiten tüchtig, bauen Strassen und Tunnel, tragen Papier hin und her und wenn sie am Abend nicht zusammen feiern, ins Theater oder an Konzerte gehen, so baden sie im Fluss, der sich durch die Stadt schlängelt. Ansonsten schlafen sie viel und leben gesund und sportlich. Es war ein schönes und ruhiges Leben, bis im Jahr 2005 der Spiegel zerbrach.
Kultur als Spiegel der Gesellschaft.
1996 wurde von der Abteilung Kulturelles ein Kulturkonzept herausgegeben. Das kulturpolitische Prozedere dauerte über 3 Jahre. Eine der zwei Petitionen, die damals eingereicht wurden, hatten 63‘562 Personen gezeichnet. Das Kulturkonzept wurde von verschiedener Seite gefordert und aus diesem Material entwickelt. Neun grössere Kulturinstitutionen hatten sich zusammen dafür stark gemacht. Deren Leistungsverträge laufen im Jahr 2008 aus. Jetzt, im Jahr 2005, wird ein Nachfolgekonzept für die Zeit 2008 bis 2012 vorgestellt – oder besser, es wurde versucht vorzustellen: Das neue Leitbild der städtischen Kulturförderung, erstellt im August 2005, wurde am 23. September, noch auf dem Weg zum Stadtpräsidenten, politisch und öffentlich zurückgepfiffen. Grund dazu gab erstens die totale Veröffentlichung des Konzeptes an die Medien, noch bevor die Kulturinstitutionen dazu Stellung nehmen konnten (rund 150 Institutionen und Kulturmenschen erhielten die Dokumentation) und zweitens die überdimensionierte Wunschvorstellung von 8.7 Millionen mehr Geld für die Kulturförderung pro Jahr mit der Androhung: «…dass sich die Stadt klar zu ihrer Kultur bekennt und die nötigen Mittel bereitstellt. Finanziell den Status quo zu erhalten, würde faktisch einen Abbau bedeuten, denn mit gleich viel Geld ist heute weniger möglich als früher. Das käme die Stadt gesellschaftlich und wirtschaftlich teuer zu stehen.»
Keine Grundlage
Wer das Leitbild liest stellt schon nach den ersten Seiten die Berechtigung für diesen Rückpfiff fest. Das eigentliche Leitbild ist keines: Es hat keinen Boden, keine Wände/ Grenzen und kein Ziel/ Vision. Es fehlt das Gerüst. Die einzige Begründung für die 8.7 Millionen sind im Satz «es ist Zeit» zu finden. Die letzte Analyse vom Kulturmarkt Bern wurde 1993 durchgeführt – pro Kultur notabene – um eben mitunter die damals laufenden Petitionen zu stützen. Aber seither gibt es keine Besucherstatistiken, Entwicklungsanalysen, Auswertungen… Wer behauptet, dass es in Bern immer mehr Kulturinteressierte gibt, muss dies begründen können. Es wäre falsch, nur die Museumsnacht oder die wirklich historischen Grossevents im Historischen Museum als Referenz zu betrachten. Das gehört zu «Eventitis» – eine ganz andere Zeiterscheinung. Dazu kommt, dass gerade jene Veranstalter, die am meisten Zuwachs in den letzten Jahren verzeichnen konnten, von der städtischen Förderung praktisch ausgeschlossen waren: Be-Jazz, Theater an der Effingerstrasse,Wasserwerk, Music Bistrot, ISC, La Cappella, Appalooza GmbH (Bierhübeli, BEA Nights und Gurtenfestival) und Pulls Production AG (ehemals Bierhübeli, Festivals), OFF-Kinos, Galerien und noch mehr. Gerade diese Institutionen haben Publikumsmagnete geschaffen und sind die Entwicklungshelfer in der Berner Kultur. Die gross subventionierten Institutionen mussten teils bedenklich um die Publikumsgunst buhlen.
Wohin des Weges?
Die Bodenlosigkeit hat aber noch eine andere, viel gefährlichere Tendenz: Es fehlt die Philosophie – darüber täuschen auch einige Kalendersprüche auf der Titelseite des Leitbildes nicht hinweg. Im Konzept werden Zahlen und Fakten dem Sinn und den Fragen übergeordnet. Ebenfalls bleibt die Diskussion aus: die 76 Seiten sind ohne Namen publiziert. Es wird behauptet, aber nicht visioniert oder handfest begründet. Die Visionen sind Wünsche - und die sind so nicht brauchbar. Kein Kurs, keine Umsetzung, kein Plan. Der einzige gesellschaftlich handfeste Stützpunkt liefert noch die Fussball-EM 2008. Danach gibt’s anscheinend nichts mehr bis im Jahr 2012. Das Leitbild hat, bemühend «umfassend zu sein», sich mehr um die Kosten, als um die Qualität getrieben. Die simple Frage nach «Ist das was wir haben auch gut genug, um weiterhin finanziert zu werden?», wird nicht beantwortet. Keine Einsparung, da alles nur super ist, was Bern produziert. Die NZZ am Sonntag kommentierte die Berner Kultur am 25. September 2005 so: «Mani Matter ist tot, die Reithalle ein Abglanz alter Zeiten und Kuno Lauener ein wandelndes Selbstzitat.» Wird Bern in Zukunft die kulturelle Lachnummer der Nation? Unlängst hat uns Zürich mit dem Züri-Dialekt den «Eugen» entwendet: «Dadurch bekommt die Handlung jenen zürcherischen Dreh, den eine hiesiges Kulturprodukt braucht, um schweizweit bemerkt zu werden.» So die «internationale» NZZ. Es sind böse Worte. Was sind wir denn? Tanzstadt, Jazzstadt, Popstadt, Theaterstadt, Museumsstadt, Symphoniestadt, Literaturstadt, Filmstadt, Kunststadt, Bärenstadt? Oder alles ein bischen? Wo liegt der Fokus?
Streichkonzert
Mit der Absage vom Finanzamt, aber auch vom Gemeinderat, hat das Konzert einen neuen Klang erhalten. Im Leitbild ist eine Sparvariante budgetiert, doch die ist immer noch zu hoch. Das Problem dieses Leitbildes ist nun, dass man – weil keine philosophische Vision zugrunde liegt – das gesamte Konzept wegwerfen und neu machen muss. Es genügt nicht die Zahlen zu ändern – die «Fakten» sind ja gleich geblieben. Was vorangehend so wünschenswert hätte gefördert werden sollen, muss jetzt abgestrichen werden und man kommt wieder zum gleichen Budget, welches wir jetzt haben. Oder aber man nimmt sich die teueren Institutionen vor und streicht dort... – kaum anzunehmen. Unter dem Strich wird also die «kleine Künstlerin» die Verliererin sein und die Giesskanne wird weiter dort giessen, wo der Boden schon überdüngt und unfruchtbar ist.
Wer tut was
Diese Problematik der Stadt Bern könnte aber einen Hinweis darauf geben, dass Kulturförderung nicht zu verwechseln ist mit «Kultur machen». In vielen Beispielen hat die Abteilung Kulturelles Institutionen «selber» auf die Beine gestellt, die bereits Privatwirtschaftlich funktionierten. Sie konkurriert damit zum Teil die Privatwirtschaft und ignoriert den Markt, der überall zu berücksichtigen ist, auch in der Kultur. Als ernstes Beispiel gilt dabei die Bern-Billet-Zentrale, welche auf dem Platz Bern für Veranstalter als die Teuerste und Unbequemste funktioniert und der Stadt nette Unkosten verursacht. Dass die Vorprojekte von Bern-Billet schon zwei Mal Konkurs gingen, davon redet niemand. Die Abteilung Kulturelles ist sogar stolz auf die Dienstleistung dieser Billet-Zentrale, obwohl der Ansturm der Veranstalter in die Gegenrichtung verläuft. Das Debakel der Berner Kulturagenda muss man kaum erwähnen. Es ist ebenfalls eine Eigenleistung, welche viel Geld kostet und nicht befriedigt. Die einzigen Firmen, welche sich hierbei die Hände mit städtischem Geld reiben können, sind die Espace Medien AG (Druck des Heftes) und die produzierenden Republica AG und Quer AG (sie gehören zu der Contexta-Werbeagentur- Dynastie).
Kulturmarkt
Eine gewisse Wirtschaftlichkeit muss einem Kulturbetrieb zugemutet werden – und diese darf von einer Stadt gefordert werden. Das hat auf die Kreativität und die der Künstlerin noch keinen direkten Einfluss. Die Institution oder der Veranstalter macht ja nicht die Kunst an sich, sondern präsentiert jene. Dafür gibt’s ausgebildetes Personal und Leistungsverträge, welche die Künste schützen und ein Publikum, welches gewonnen werden muss. Das gilt genau so für ein Stadttheater oder die Museen, wie für den PROGR oder die Villa Bernau. Aber noch viel schwieriger würde die private Förderung in Unordnung gebracht: Wenn sich das neue Kulturleitbild durchsetzten würde, so wäre es das Aus für das Kultursponsoring von der Wirtschaft oder von Privaten. Es gäbe keinen Sinn mehr, neben den Grossförderern Stadt und der MIGROS Kulturprozent Geld in die Kultur zu investieren. Dies könnte ins Auge gehen. Die Marktgesetze gelten ebenfalls für die Künstlerinnen. Es darf nicht sein, dass wir die Kulturschaffenden vollumfänglich auf Wolke 7 tragen. Das Schaffen braucht eine Zukunft. Kunst für die Kunst sollte eine Randerscheinung und einen kleinen Kostenteil ausmachen. Ein Schauspieler muss gut sein und kein Maler hat ein Recht auf den Ankauf seiner Bilder - es muss ein Wert geschaffen werden. Und das braucht Zeit. Die gewünschte Kulturförderung der Stadt Bern geht dabei in die falsche Richtung. Christoph Reichenau, Leiter der Abteilung Kulturelles und Verantwortlicher für das neue Leitbild, bringt es auf den Punkt: ‚Mit diesem Betrag (die 8.7 Millionen/ Anmerk. Redaktion) sei die hiesige Kulturszene «nicht mehr unterfinanziert» und deshalb seien auch am einen oder anderen Ort mehr Spitzenleistungen zu erwarten.‘ (Zitat «Der Bund» vom 17. September 2005) Mit anderen Worten heisst dies, dass man die Spitzenleistungen noch nicht gefunden hat! Und jetzt, mit einer massigen Investition, suchen will. So kann natürlich kein Förderungskonzept funktionieren.
Fazit
Eines ist nach der Lektüre auf jeden Fall klar: 8.7 Millionen sind viel zu viel. Das Leitbild widerspiegelt aber ein zeitgenössisches Denken und kann als Lerndokumentation durchaus herhalten. Es ist ein Bekenntnis zur Visionslosigkeit - nicht eines zur Kultur - also zeitgenössisch. Wir können jetzt einem spannenden Kulturdialog entgegensehen und uns für die nächsten 3 Jahre zusammensetzen. Das viele Papier stellen wir ins Regal, die Kultur in Bern würde darin ersticken und der Spiegel würde für eine lange Zeit zerbrochen bleiben.
Dieser Artikel erschien zuerst in der Print Ausgabe des Berner ensuite kulturmagazin
Kultur als Spiegel der Gesellschaft.
1996 wurde von der Abteilung Kulturelles ein Kulturkonzept herausgegeben. Das kulturpolitische Prozedere dauerte über 3 Jahre. Eine der zwei Petitionen, die damals eingereicht wurden, hatten 63‘562 Personen gezeichnet. Das Kulturkonzept wurde von verschiedener Seite gefordert und aus diesem Material entwickelt. Neun grössere Kulturinstitutionen hatten sich zusammen dafür stark gemacht. Deren Leistungsverträge laufen im Jahr 2008 aus. Jetzt, im Jahr 2005, wird ein Nachfolgekonzept für die Zeit 2008 bis 2012 vorgestellt – oder besser, es wurde versucht vorzustellen: Das neue Leitbild der städtischen Kulturförderung, erstellt im August 2005, wurde am 23. September, noch auf dem Weg zum Stadtpräsidenten, politisch und öffentlich zurückgepfiffen. Grund dazu gab erstens die totale Veröffentlichung des Konzeptes an die Medien, noch bevor die Kulturinstitutionen dazu Stellung nehmen konnten (rund 150 Institutionen und Kulturmenschen erhielten die Dokumentation) und zweitens die überdimensionierte Wunschvorstellung von 8.7 Millionen mehr Geld für die Kulturförderung pro Jahr mit der Androhung: «…dass sich die Stadt klar zu ihrer Kultur bekennt und die nötigen Mittel bereitstellt. Finanziell den Status quo zu erhalten, würde faktisch einen Abbau bedeuten, denn mit gleich viel Geld ist heute weniger möglich als früher. Das käme die Stadt gesellschaftlich und wirtschaftlich teuer zu stehen.»
Keine Grundlage
Wer das Leitbild liest stellt schon nach den ersten Seiten die Berechtigung für diesen Rückpfiff fest. Das eigentliche Leitbild ist keines: Es hat keinen Boden, keine Wände/ Grenzen und kein Ziel/ Vision. Es fehlt das Gerüst. Die einzige Begründung für die 8.7 Millionen sind im Satz «es ist Zeit» zu finden. Die letzte Analyse vom Kulturmarkt Bern wurde 1993 durchgeführt – pro Kultur notabene – um eben mitunter die damals laufenden Petitionen zu stützen. Aber seither gibt es keine Besucherstatistiken, Entwicklungsanalysen, Auswertungen… Wer behauptet, dass es in Bern immer mehr Kulturinteressierte gibt, muss dies begründen können. Es wäre falsch, nur die Museumsnacht oder die wirklich historischen Grossevents im Historischen Museum als Referenz zu betrachten. Das gehört zu «Eventitis» – eine ganz andere Zeiterscheinung. Dazu kommt, dass gerade jene Veranstalter, die am meisten Zuwachs in den letzten Jahren verzeichnen konnten, von der städtischen Förderung praktisch ausgeschlossen waren: Be-Jazz, Theater an der Effingerstrasse,Wasserwerk, Music Bistrot, ISC, La Cappella, Appalooza GmbH (Bierhübeli, BEA Nights und Gurtenfestival) und Pulls Production AG (ehemals Bierhübeli, Festivals), OFF-Kinos, Galerien und noch mehr. Gerade diese Institutionen haben Publikumsmagnete geschaffen und sind die Entwicklungshelfer in der Berner Kultur. Die gross subventionierten Institutionen mussten teils bedenklich um die Publikumsgunst buhlen.
Wohin des Weges?
Die Bodenlosigkeit hat aber noch eine andere, viel gefährlichere Tendenz: Es fehlt die Philosophie – darüber täuschen auch einige Kalendersprüche auf der Titelseite des Leitbildes nicht hinweg. Im Konzept werden Zahlen und Fakten dem Sinn und den Fragen übergeordnet. Ebenfalls bleibt die Diskussion aus: die 76 Seiten sind ohne Namen publiziert. Es wird behauptet, aber nicht visioniert oder handfest begründet. Die Visionen sind Wünsche - und die sind so nicht brauchbar. Kein Kurs, keine Umsetzung, kein Plan. Der einzige gesellschaftlich handfeste Stützpunkt liefert noch die Fussball-EM 2008. Danach gibt’s anscheinend nichts mehr bis im Jahr 2012. Das Leitbild hat, bemühend «umfassend zu sein», sich mehr um die Kosten, als um die Qualität getrieben. Die simple Frage nach «Ist das was wir haben auch gut genug, um weiterhin finanziert zu werden?», wird nicht beantwortet. Keine Einsparung, da alles nur super ist, was Bern produziert. Die NZZ am Sonntag kommentierte die Berner Kultur am 25. September 2005 so: «Mani Matter ist tot, die Reithalle ein Abglanz alter Zeiten und Kuno Lauener ein wandelndes Selbstzitat.» Wird Bern in Zukunft die kulturelle Lachnummer der Nation? Unlängst hat uns Zürich mit dem Züri-Dialekt den «Eugen» entwendet: «Dadurch bekommt die Handlung jenen zürcherischen Dreh, den eine hiesiges Kulturprodukt braucht, um schweizweit bemerkt zu werden.» So die «internationale» NZZ. Es sind böse Worte. Was sind wir denn? Tanzstadt, Jazzstadt, Popstadt, Theaterstadt, Museumsstadt, Symphoniestadt, Literaturstadt, Filmstadt, Kunststadt, Bärenstadt? Oder alles ein bischen? Wo liegt der Fokus?
Streichkonzert
Mit der Absage vom Finanzamt, aber auch vom Gemeinderat, hat das Konzert einen neuen Klang erhalten. Im Leitbild ist eine Sparvariante budgetiert, doch die ist immer noch zu hoch. Das Problem dieses Leitbildes ist nun, dass man – weil keine philosophische Vision zugrunde liegt – das gesamte Konzept wegwerfen und neu machen muss. Es genügt nicht die Zahlen zu ändern – die «Fakten» sind ja gleich geblieben. Was vorangehend so wünschenswert hätte gefördert werden sollen, muss jetzt abgestrichen werden und man kommt wieder zum gleichen Budget, welches wir jetzt haben. Oder aber man nimmt sich die teueren Institutionen vor und streicht dort... – kaum anzunehmen. Unter dem Strich wird also die «kleine Künstlerin» die Verliererin sein und die Giesskanne wird weiter dort giessen, wo der Boden schon überdüngt und unfruchtbar ist.
Wer tut was
Diese Problematik der Stadt Bern könnte aber einen Hinweis darauf geben, dass Kulturförderung nicht zu verwechseln ist mit «Kultur machen». In vielen Beispielen hat die Abteilung Kulturelles Institutionen «selber» auf die Beine gestellt, die bereits Privatwirtschaftlich funktionierten. Sie konkurriert damit zum Teil die Privatwirtschaft und ignoriert den Markt, der überall zu berücksichtigen ist, auch in der Kultur. Als ernstes Beispiel gilt dabei die Bern-Billet-Zentrale, welche auf dem Platz Bern für Veranstalter als die Teuerste und Unbequemste funktioniert und der Stadt nette Unkosten verursacht. Dass die Vorprojekte von Bern-Billet schon zwei Mal Konkurs gingen, davon redet niemand. Die Abteilung Kulturelles ist sogar stolz auf die Dienstleistung dieser Billet-Zentrale, obwohl der Ansturm der Veranstalter in die Gegenrichtung verläuft. Das Debakel der Berner Kulturagenda muss man kaum erwähnen. Es ist ebenfalls eine Eigenleistung, welche viel Geld kostet und nicht befriedigt. Die einzigen Firmen, welche sich hierbei die Hände mit städtischem Geld reiben können, sind die Espace Medien AG (Druck des Heftes) und die produzierenden Republica AG und Quer AG (sie gehören zu der Contexta-Werbeagentur- Dynastie).
Kulturmarkt
Eine gewisse Wirtschaftlichkeit muss einem Kulturbetrieb zugemutet werden – und diese darf von einer Stadt gefordert werden. Das hat auf die Kreativität und die der Künstlerin noch keinen direkten Einfluss. Die Institution oder der Veranstalter macht ja nicht die Kunst an sich, sondern präsentiert jene. Dafür gibt’s ausgebildetes Personal und Leistungsverträge, welche die Künste schützen und ein Publikum, welches gewonnen werden muss. Das gilt genau so für ein Stadttheater oder die Museen, wie für den PROGR oder die Villa Bernau. Aber noch viel schwieriger würde die private Förderung in Unordnung gebracht: Wenn sich das neue Kulturleitbild durchsetzten würde, so wäre es das Aus für das Kultursponsoring von der Wirtschaft oder von Privaten. Es gäbe keinen Sinn mehr, neben den Grossförderern Stadt und der MIGROS Kulturprozent Geld in die Kultur zu investieren. Dies könnte ins Auge gehen. Die Marktgesetze gelten ebenfalls für die Künstlerinnen. Es darf nicht sein, dass wir die Kulturschaffenden vollumfänglich auf Wolke 7 tragen. Das Schaffen braucht eine Zukunft. Kunst für die Kunst sollte eine Randerscheinung und einen kleinen Kostenteil ausmachen. Ein Schauspieler muss gut sein und kein Maler hat ein Recht auf den Ankauf seiner Bilder - es muss ein Wert geschaffen werden. Und das braucht Zeit. Die gewünschte Kulturförderung der Stadt Bern geht dabei in die falsche Richtung. Christoph Reichenau, Leiter der Abteilung Kulturelles und Verantwortlicher für das neue Leitbild, bringt es auf den Punkt: ‚Mit diesem Betrag (die 8.7 Millionen/ Anmerk. Redaktion) sei die hiesige Kulturszene «nicht mehr unterfinanziert» und deshalb seien auch am einen oder anderen Ort mehr Spitzenleistungen zu erwarten.‘ (Zitat «Der Bund» vom 17. September 2005) Mit anderen Worten heisst dies, dass man die Spitzenleistungen noch nicht gefunden hat! Und jetzt, mit einer massigen Investition, suchen will. So kann natürlich kein Förderungskonzept funktionieren.
Fazit
Eines ist nach der Lektüre auf jeden Fall klar: 8.7 Millionen sind viel zu viel. Das Leitbild widerspiegelt aber ein zeitgenössisches Denken und kann als Lerndokumentation durchaus herhalten. Es ist ein Bekenntnis zur Visionslosigkeit - nicht eines zur Kultur - also zeitgenössisch. Wir können jetzt einem spannenden Kulturdialog entgegensehen und uns für die nächsten 3 Jahre zusammensetzen. Das viele Papier stellen wir ins Regal, die Kultur in Bern würde darin ersticken und der Spiegel würde für eine lange Zeit zerbrochen bleiben.
Dieser Artikel erschien zuerst in der Print Ausgabe des Berner ensuite kulturmagazin
sfux - 18. Okt, 18:37 Article 1366x read