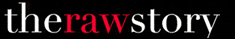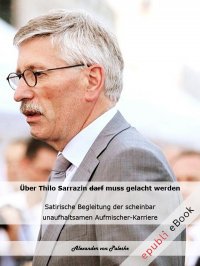Guten Morgen Bern - RaBe strahlt
Stephan Fuchs - Das Berner Radio RaBe feiert zehn Jahre Ätherkultur. Grund genug das Bestehen, die MacherInnen und die Idee zum einzigen freien Radio von Bern zu feiern. Stadtweit. RaBe ist ein nicht wegzudenkendes Stück Berner-, wenn nicht gar Schweizer Radiogeschichte. Für das kulturmagazin ensuite und Stephan Fuchs Anlass, mit dem Mitinitiator, Rechtsanwalt und Radiomacher Dr. Willi Egloff Kaffee zu trinken.
Herr Willi Egloff, Bern feiert 10 Jahre RaBe. Herzliche Gratulation. Aber braucht es in Bern überhaupt ein Radio RaBe?
Auf jeden Fall. Radio RaBe braucht es. Erstens weil wir grössere Bevölkerungssegmente haben, die in den Medien überhaupt nicht zu Wort kommen. Zweitens braucht es Radio RaBe, weil es das einzige wirklich zweiseitige Radio ist. Ein Radio das keine klare Trennung zwischen Macher und Publikum kennt, sondern wo sich jeder und jede aktiv an der Gestaltung dieses Mediums beteiligen kann. Schliesslich braucht es Radio RaBe auch, weil grosse Kulturbereiche in anderen Radios schlicht ausgeblendet bleiben.

Sie sagen Radio RaBe braucht es. RaBe ist aber auch ein Freies Radio, es ist Bestand von AMARC, der World Association of Community Radio Broadcasters. Ein linkes Oppositionsradio in einer links regierten Stadt? Das versteh ich nicht.
Das ist durchaus richtig. RaBe ist in dem Sinne oppositionell oder ergänzend, dass es sich primär dem widmet, was in den anderen Radios nicht stattfindet, aber eigentlich genau so berechtigt ist. Wenn sie sich die musikalische Programmierung von DRS 1, 2 oder 3 anschauen, dann gibt es da klar Bereiche die nicht berücksichtigt werden. Zum Beispiel im Hip-Hop, oder in der experimentellen Musik. Sicher, bei Radio DRS ist die Musikauswahl viel breiter als bei den Berner Radios BE1 und CapitalFM, wie das jetzt offenbar heisst. Es gibt daneben aber noch eine sehr breite Palette relevanter Musik… und die spielt Radio RaBe.
Es geht ja aber nicht nur um Musik, sondern auch um Inhalt…
…natürlich geht es auch um Inhalt. Inhalt, der in der relativ einförmigen Schweizer Presselandschaft auch praktisch nicht vertreten ist. Alternative Informationen.
Und wie darf ich das verstehen?
Man darf politische Information nicht an der parlamentarischen Politik festmachen, denn jene repräsentiert ja auch nur einen Teil unserer Bevölkerung. In der Stadt Bern leben19% der Einwohnerinnen und Einwohner ohne Schweizer Pass. Ihre Anliegen finden in der Politik schlicht nicht statt, denn sie versprechen keinen Wahlstimmen-Anteil. Bei Radio RaBe bekommen sie eine eigene Stimme und werden akzeptiert. Es gibt auch grössere Segmente der Bevölkerung die sich an der parlamentarischen Politik nicht beteiligen, obwohl sie das Stimmrecht hätten. Auch sie- und das sind nicht nur Junge - finden über RaBe Gehör. Man kann eben durchaus in rot-grüner Opposition zur RGM-Politik stehen, das ist eine gesunde Opposition.
Verstehen sie RaBe auch als Instrument die Pressefreiheit aufrecht zu erhalten?
Es ist schon auffallend, dass RaBe von den Berner Zeitungen seit Anbeginn totgeschwiegen wird. Die einzige Nachricht über uns in den Berner Tageszeitungen war, dass Radio RaBe demnächst sterben werde. Das wurde vor zehn und dann vor neun Jahren geschrieben und noch einige Male wiederholt, bis auch das niemand mehr glaubte. Seither war RaBe in den Berner Medien nicht mehr präsent. Der „Bund“ hat wenigstens unsere Programme abgedruckt, die „Berner Zeitung“ konnten wir nur mit massivem Druck dazu bringen, dass sie auf der Radioseite auch unser Programm abdruckte. Wir mussten ihr eine Kartellklage androhen, weil sie ihr eigenes Radio Extra Bern mit der Nichterwähnung unseres Senders privilegiert haben.
Das ist starker Tobak.
Richtig.
Ist denn RaBe überhaupt eine Konkurrenz gegenüber den Flachlandradios der Stadt Bern?
Ja und Nein. Die anderen Stationen in der Stadt Bern sind als Begleitradios konzipiert, wir nicht.
Was heisst das?
Das heisst: Sie fahren Auto oder arbeiten im Büro und hinten dran plätschert das Radio. RaBe hingegen ist ein „Einschalt Radio“. HörerInnen schalten bewusst RaBe ein, weil sie aktiv Musik hören möchten oder eine Sendung mitverfolgen wollen, die sie interessiert. Wir konzipieren aber einen Teil des Programms auch als Begleitradio. Dort wird RaBe zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz.
Wie verhält sich der Marktanteil?
Das ist eine schwierige Diskussion und es ist dabei zu definieren was Marktanteil heisst. Wir haben eine sehr grosse maximale Reichweite. Das heisst, es gibt sehr viele Leute, die im Verlauf eines Monats Radio RaBe einschalten. Das sind mehr Menschen als zum Beispiel beim ehemaligen Radio Extra Bern. Wenn man allerdings von Marktanteil spricht, dann spricht man in der Regel von der Tagesreichweite und dabei liegen wir im Schnitt zurück, da unser Radio eben nicht unbedingt ein Begleitradio ist.
Sie sind Mitinitiator von RaBe, sie machen selber auch aktiv eine Sendung, sie kommentieren dabei politisch aktuelle Themen und illustrieren sie mit klassischer Musik. Das ist ein aufwändiges und teures Hobby.
Ja, das ist ein teures Hobby. Radio RaBe ist für mich eben etwas, das ich nicht aus kommerziellen Überlegungen mache. Wenn ich da eine Sendung produziere, dann ist das nicht nur sehr viel Arbeit, sondern ich muss dafür auch noch bezahlen. Radio machen und unterhalten ist eine teure Sache, da haben sie Recht. Obwohl viele Leute ehrenamtlich mitmachen und das Radio mitgestalten, entstehen enorme Kosten, vor allem in der Infrastruktur. Wir werden vom BAKOM subventioniert, der Rest wird fast ausschliesslich von den rund 500 Mitgliedern getragen.
Wie drückt sich das in Finanzzahlen aus?
Das Radio kostet jährlich eine halbe Million Franken. Dabei wird rund die Hälfte für reine Technikkosten, für Übermittlungskosten und andere Fixkosten aufgewendet. Das sind ausschliesslich Kosten, überhaupt senden zu können. Da gibt es keine Sparmöglichkeiten.
Das ist, nach Abzug der BAKOM Subvention wohl ein recht grosser Batzen der von den Mitgliedern getragen werden muss. Ist Radio RaBe die Geschichte des Robin Hood?
Vielleicht ja. Radio RaBe ist etwas wichtiges, das man nicht aus kommerziellen Überlegungen macht. Es gibt in der Schweiz aber viele Menschen, die Geld für Freizeitaktivitäten ausgeben, die einem grösseren Interesse und der Öffentlichkeit dienen. Zum Glück! Also insofern ist das Engagement für Radio RaBe nicht eine Ausnahmeerscheinung.
Ist RaBe fähig, technisch und konzeptionell eine Entwicklung durchzumachen?
Ja natürlich. Vor zehn Jahren war Radio machen bei uns ganz anders. Damals lief alles über Freiwilligenarbeit. Heute gibt es eine personelle Infrastruktur. MitarbeiterInnen, die ein Minimum an Lohn garantiert bekommen und die sicherstellen, dass der Betrieb funktioniert. Dann sicher auch die Sendetechnik, die sehr viel raffinierter geworden ist und dafür sorgt, dass Ausfälle fast nicht mehr vorkommen können. Das ist für die MacherInnen, aber auch für die HörerInnen eine wichtige Sicherheit. Wir sind heute auch viel besser in der Lage, Direktübertragungen zu realisieren, wir können raus zu den Menschen – ein wichtiger Schritt. Wir haben aus unseren Erfahrungen viel gelernt und die Programmstruktur hat sich weiterentwickelt.
Inwiefern?
Insofern, dass wir das Programm besser und kompakter gliedern. Die Rockliebhaberin soll wissen, an welchem Tag sie das zu hören bekommt, was ihr am liebsten ist. Ebenso die Informations- und die fremdsprachigen Sendungen. Das ist einwichtiger Schritt, hin zum aktiven Hören.
Sie haben eben die Fremdsprachen angesprochen, auf die sie im Radio grossen Wert legen. Da kommen mir schon Gedanken, die auch ein Freies Radio an die Grenzen bringen kann.
Wie meinen sie das?
Ich denke das könnte bisweilen ja recht kompliziert werden, wenn sich zwei Menschen aus einer Kriegsregion begegnen… Noch markanter die Vorstellung, wenn jemand zum Terror aufrufen sollte. Kommen sie da nicht in einen Clinch mit der Freiheit?
Die Frage stellt sich und hat sich auch schon gestellt. Übrigens stellt sich diese Frage auch bei RadiomacherInnen mit Schweizer Pass. In jedem Medium. Es ist natürlich besonders aktuell, wenn wir Radiomacherinnen und Radiomacher aus Krisengebieten haben. Wir mussten schon während des Kosovokrieges serbische und albanische RadiomacherInnen aneinander vorbei schleusen. Trotzdem – oder erst recht -geben wir ihnen eine Stimme. Sie wohnen bei uns, sie haben etwas zu sagen. Wir wollen zur Kommunikation zwischen diesen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, zur sozialen Integration beitragen. Die Sendungen drehen sich daher in der Regel, auch die fremdsprachigen, um Belange der Region Bern oder Stadt Bern. Dass jemand zum Terror aufruft, das halte ich nicht für möglich.
Was macht sie da so sicher? Kein Berner versteht diese Sprachen…
Wir schon. In unsrer Programmkommission sitzen Leute, die diese Sprachen verstehen. Wenn das nicht der Fall ist, ziehen wir Leute mit den entsprechenden Sprachkenntnissen bei. Wir wissen was im Programm ist. Das ist nicht eine „Gesinnungskontrolle“, sondern eine Qualitätskontrolle, wie sie in jedem Radio betrieben wird. Wir haben schliesslich eine redaktionelle und eine rechtliche Verantwortung.
Sehen sie RaBe überhaupt als ein politisches Sprachrohr?
Nein, nicht unbedingt. Selbstverständlich wurde das Radio als linkes Radio konzipiert, dabei geht es aber mehr um gesellschaftspolitische und kulturpolitische Aspekte als um parlamentarische Fragen. Es geht um Information, aber vor allem auch um Musik, um Kultur und Kulturaustausch.
Rabe hat sich in den zehn Jahren gewandelt. Auch personell. Haben sie ein Problem mit den Generationenwechseln?
Nein im Gegenteil, das ist ein Aufsteller. Das zeigt, dass die Idee tragfähig und nachhaltig ist.
Herr Doktor Egloff, ich bedanke mich für das anregende Gespräch und wünsche ihnen und den MacherInnen von Radio RaBe weiterhin gute und spannende Radiosendungen.
 Radio RaBe
Radio RaBe
 Das Interview erschien erstmalig in der Print Ausgabe des Berner kulturmagazin ensuite
Das Interview erschien erstmalig in der Print Ausgabe des Berner kulturmagazin ensuite
Herr Willi Egloff, Bern feiert 10 Jahre RaBe. Herzliche Gratulation. Aber braucht es in Bern überhaupt ein Radio RaBe?
Auf jeden Fall. Radio RaBe braucht es. Erstens weil wir grössere Bevölkerungssegmente haben, die in den Medien überhaupt nicht zu Wort kommen. Zweitens braucht es Radio RaBe, weil es das einzige wirklich zweiseitige Radio ist. Ein Radio das keine klare Trennung zwischen Macher und Publikum kennt, sondern wo sich jeder und jede aktiv an der Gestaltung dieses Mediums beteiligen kann. Schliesslich braucht es Radio RaBe auch, weil grosse Kulturbereiche in anderen Radios schlicht ausgeblendet bleiben.

Sie sagen Radio RaBe braucht es. RaBe ist aber auch ein Freies Radio, es ist Bestand von AMARC, der World Association of Community Radio Broadcasters. Ein linkes Oppositionsradio in einer links regierten Stadt? Das versteh ich nicht.
Das ist durchaus richtig. RaBe ist in dem Sinne oppositionell oder ergänzend, dass es sich primär dem widmet, was in den anderen Radios nicht stattfindet, aber eigentlich genau so berechtigt ist. Wenn sie sich die musikalische Programmierung von DRS 1, 2 oder 3 anschauen, dann gibt es da klar Bereiche die nicht berücksichtigt werden. Zum Beispiel im Hip-Hop, oder in der experimentellen Musik. Sicher, bei Radio DRS ist die Musikauswahl viel breiter als bei den Berner Radios BE1 und CapitalFM, wie das jetzt offenbar heisst. Es gibt daneben aber noch eine sehr breite Palette relevanter Musik… und die spielt Radio RaBe.
Es geht ja aber nicht nur um Musik, sondern auch um Inhalt…
…natürlich geht es auch um Inhalt. Inhalt, der in der relativ einförmigen Schweizer Presselandschaft auch praktisch nicht vertreten ist. Alternative Informationen.
Und wie darf ich das verstehen?
Man darf politische Information nicht an der parlamentarischen Politik festmachen, denn jene repräsentiert ja auch nur einen Teil unserer Bevölkerung. In der Stadt Bern leben19% der Einwohnerinnen und Einwohner ohne Schweizer Pass. Ihre Anliegen finden in der Politik schlicht nicht statt, denn sie versprechen keinen Wahlstimmen-Anteil. Bei Radio RaBe bekommen sie eine eigene Stimme und werden akzeptiert. Es gibt auch grössere Segmente der Bevölkerung die sich an der parlamentarischen Politik nicht beteiligen, obwohl sie das Stimmrecht hätten. Auch sie- und das sind nicht nur Junge - finden über RaBe Gehör. Man kann eben durchaus in rot-grüner Opposition zur RGM-Politik stehen, das ist eine gesunde Opposition.
Verstehen sie RaBe auch als Instrument die Pressefreiheit aufrecht zu erhalten?
Es ist schon auffallend, dass RaBe von den Berner Zeitungen seit Anbeginn totgeschwiegen wird. Die einzige Nachricht über uns in den Berner Tageszeitungen war, dass Radio RaBe demnächst sterben werde. Das wurde vor zehn und dann vor neun Jahren geschrieben und noch einige Male wiederholt, bis auch das niemand mehr glaubte. Seither war RaBe in den Berner Medien nicht mehr präsent. Der „Bund“ hat wenigstens unsere Programme abgedruckt, die „Berner Zeitung“ konnten wir nur mit massivem Druck dazu bringen, dass sie auf der Radioseite auch unser Programm abdruckte. Wir mussten ihr eine Kartellklage androhen, weil sie ihr eigenes Radio Extra Bern mit der Nichterwähnung unseres Senders privilegiert haben.
Das ist starker Tobak.
Richtig.
Ist denn RaBe überhaupt eine Konkurrenz gegenüber den Flachlandradios der Stadt Bern?
Ja und Nein. Die anderen Stationen in der Stadt Bern sind als Begleitradios konzipiert, wir nicht.
Was heisst das?
Das heisst: Sie fahren Auto oder arbeiten im Büro und hinten dran plätschert das Radio. RaBe hingegen ist ein „Einschalt Radio“. HörerInnen schalten bewusst RaBe ein, weil sie aktiv Musik hören möchten oder eine Sendung mitverfolgen wollen, die sie interessiert. Wir konzipieren aber einen Teil des Programms auch als Begleitradio. Dort wird RaBe zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz.
Wie verhält sich der Marktanteil?
Das ist eine schwierige Diskussion und es ist dabei zu definieren was Marktanteil heisst. Wir haben eine sehr grosse maximale Reichweite. Das heisst, es gibt sehr viele Leute, die im Verlauf eines Monats Radio RaBe einschalten. Das sind mehr Menschen als zum Beispiel beim ehemaligen Radio Extra Bern. Wenn man allerdings von Marktanteil spricht, dann spricht man in der Regel von der Tagesreichweite und dabei liegen wir im Schnitt zurück, da unser Radio eben nicht unbedingt ein Begleitradio ist.
Sie sind Mitinitiator von RaBe, sie machen selber auch aktiv eine Sendung, sie kommentieren dabei politisch aktuelle Themen und illustrieren sie mit klassischer Musik. Das ist ein aufwändiges und teures Hobby.
Ja, das ist ein teures Hobby. Radio RaBe ist für mich eben etwas, das ich nicht aus kommerziellen Überlegungen mache. Wenn ich da eine Sendung produziere, dann ist das nicht nur sehr viel Arbeit, sondern ich muss dafür auch noch bezahlen. Radio machen und unterhalten ist eine teure Sache, da haben sie Recht. Obwohl viele Leute ehrenamtlich mitmachen und das Radio mitgestalten, entstehen enorme Kosten, vor allem in der Infrastruktur. Wir werden vom BAKOM subventioniert, der Rest wird fast ausschliesslich von den rund 500 Mitgliedern getragen.
Wie drückt sich das in Finanzzahlen aus?
Das Radio kostet jährlich eine halbe Million Franken. Dabei wird rund die Hälfte für reine Technikkosten, für Übermittlungskosten und andere Fixkosten aufgewendet. Das sind ausschliesslich Kosten, überhaupt senden zu können. Da gibt es keine Sparmöglichkeiten.
Das ist, nach Abzug der BAKOM Subvention wohl ein recht grosser Batzen der von den Mitgliedern getragen werden muss. Ist Radio RaBe die Geschichte des Robin Hood?
Vielleicht ja. Radio RaBe ist etwas wichtiges, das man nicht aus kommerziellen Überlegungen macht. Es gibt in der Schweiz aber viele Menschen, die Geld für Freizeitaktivitäten ausgeben, die einem grösseren Interesse und der Öffentlichkeit dienen. Zum Glück! Also insofern ist das Engagement für Radio RaBe nicht eine Ausnahmeerscheinung.
Ist RaBe fähig, technisch und konzeptionell eine Entwicklung durchzumachen?
Ja natürlich. Vor zehn Jahren war Radio machen bei uns ganz anders. Damals lief alles über Freiwilligenarbeit. Heute gibt es eine personelle Infrastruktur. MitarbeiterInnen, die ein Minimum an Lohn garantiert bekommen und die sicherstellen, dass der Betrieb funktioniert. Dann sicher auch die Sendetechnik, die sehr viel raffinierter geworden ist und dafür sorgt, dass Ausfälle fast nicht mehr vorkommen können. Das ist für die MacherInnen, aber auch für die HörerInnen eine wichtige Sicherheit. Wir sind heute auch viel besser in der Lage, Direktübertragungen zu realisieren, wir können raus zu den Menschen – ein wichtiger Schritt. Wir haben aus unseren Erfahrungen viel gelernt und die Programmstruktur hat sich weiterentwickelt.
Inwiefern?
Insofern, dass wir das Programm besser und kompakter gliedern. Die Rockliebhaberin soll wissen, an welchem Tag sie das zu hören bekommt, was ihr am liebsten ist. Ebenso die Informations- und die fremdsprachigen Sendungen. Das ist einwichtiger Schritt, hin zum aktiven Hören.
Sie haben eben die Fremdsprachen angesprochen, auf die sie im Radio grossen Wert legen. Da kommen mir schon Gedanken, die auch ein Freies Radio an die Grenzen bringen kann.
Wie meinen sie das?
Ich denke das könnte bisweilen ja recht kompliziert werden, wenn sich zwei Menschen aus einer Kriegsregion begegnen… Noch markanter die Vorstellung, wenn jemand zum Terror aufrufen sollte. Kommen sie da nicht in einen Clinch mit der Freiheit?
Die Frage stellt sich und hat sich auch schon gestellt. Übrigens stellt sich diese Frage auch bei RadiomacherInnen mit Schweizer Pass. In jedem Medium. Es ist natürlich besonders aktuell, wenn wir Radiomacherinnen und Radiomacher aus Krisengebieten haben. Wir mussten schon während des Kosovokrieges serbische und albanische RadiomacherInnen aneinander vorbei schleusen. Trotzdem – oder erst recht -geben wir ihnen eine Stimme. Sie wohnen bei uns, sie haben etwas zu sagen. Wir wollen zur Kommunikation zwischen diesen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, zur sozialen Integration beitragen. Die Sendungen drehen sich daher in der Regel, auch die fremdsprachigen, um Belange der Region Bern oder Stadt Bern. Dass jemand zum Terror aufruft, das halte ich nicht für möglich.
Was macht sie da so sicher? Kein Berner versteht diese Sprachen…
Wir schon. In unsrer Programmkommission sitzen Leute, die diese Sprachen verstehen. Wenn das nicht der Fall ist, ziehen wir Leute mit den entsprechenden Sprachkenntnissen bei. Wir wissen was im Programm ist. Das ist nicht eine „Gesinnungskontrolle“, sondern eine Qualitätskontrolle, wie sie in jedem Radio betrieben wird. Wir haben schliesslich eine redaktionelle und eine rechtliche Verantwortung.
Sehen sie RaBe überhaupt als ein politisches Sprachrohr?
Nein, nicht unbedingt. Selbstverständlich wurde das Radio als linkes Radio konzipiert, dabei geht es aber mehr um gesellschaftspolitische und kulturpolitische Aspekte als um parlamentarische Fragen. Es geht um Information, aber vor allem auch um Musik, um Kultur und Kulturaustausch.
Rabe hat sich in den zehn Jahren gewandelt. Auch personell. Haben sie ein Problem mit den Generationenwechseln?
Nein im Gegenteil, das ist ein Aufsteller. Das zeigt, dass die Idee tragfähig und nachhaltig ist.
Herr Doktor Egloff, ich bedanke mich für das anregende Gespräch und wünsche ihnen und den MacherInnen von Radio RaBe weiterhin gute und spannende Radiosendungen.
sfux - 1. Mär, 08:36 Article 2213x read