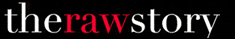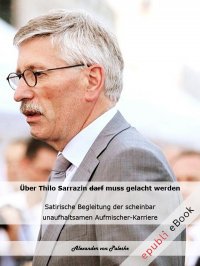Brasilien: Schock, Trauer, Wut und Resignation
Karl Weiss, Rio de Janeiro - Zuerst der Schock, dann tiefe Trauer, die übergeht in Wut auf die Verantwortlichen und schließlich in tiefer Resignation ausläuft: Das waren die Reaktionen von Millionen von Brasilianern auf das Ausscheiden der ‚seleção’ gegen Frankreich bei der Fußballweltmeisterschaft.
Sicherlich um die 90 % der Brasilianer haben das Spiel am Fernsehen verfolgt. Auch die Frauen, die sonst nicht so um Fußball besorgt sind, sitzen oder stehen bei einer ‚copa’, wie hier die Weltmeisterschaft heißt, vor dem Fernseher. Niemand konnte also verhüllen, was wirklich geschah: Frankreich war, wie schon im Finale von 1998, weit überlegen. Wäre den Brasilianern im Schlußansturm wirklich noch der Ausgleich gelungen und sie hätten eventuell das Elfmeterschießen gewonnen, wäre das ungerecht gewesen. Dabei kann man nicht einfach individuelles Versagen einzelner Spieler verantwortlich machen, sondern muß die ganze Mannschaft sehen - es gab nämlich keine Mannschaft.
Für eine kurze, aber oft glückliche Zeit ist der Brasilianer während der WM seinen Alltagsproblemen entrückt, so wie das auch im ‚Carnaval’ der Fall ist. Geht alles glücklich aus, so wie 2002, hat man einen zweiten Karneval mitten im Jahr. Aber es kann eben immer nur einer gewinnen und das ist in der überwiegenden Zahl der WMs nicht Brasilien – speziell, wenn sie in Europa ausgetragen wird.
Schweigen im Schock
So wie schon 1990 und 1998, als man ebenfalls in Spielen mit indiskutabler Leistung ausschied, macht sich dann ein Schock breit im großen südamerikanischen Land, der hauptsächlich durch Schweigen charakterisiert ist. Danach, langsam, setzt sich die Trauer durch, dann kommt die Wut auf alles, was verantwortlich gemacht werden könnte und schließlich läuft es in einer tiefen Resignation aus.
Die Probleme des Lebens in Brasilien drücken mit doppelter Wucht, können noch weniger als schon normal zur Seite geschoben werden. Die Last, die brasilianische Oligarchie auf den Schultern tragen zu müssen, verdreifacht sich. Die absurde Bürde von hohen und immer höheren Steuern (fast alle Produkte haben mehr als 50% Steuerlast im Preis), um den imperialistischen Schuldnerländern und –banken die Zinsen bezahlen zu können, wird wieder schmerzlich bewußt.
Haben die brasilianischen Stars, einschließlich Ronaldinho, dem ‚Besten der Welt’, plötzlich Fußballspielen verlernt? Sicher nicht. In den vorhergehenden Spielern hatten Einzelleistungen von einigen Spielern noch das Sichtbarwerden der mangelnden Mannschaftsleistung verhindert. Doch diesmal, gegen einen Gegner, der in Hochform spielte und sowieso eine Klasse-Elf darstellt, gegen einen Zinedine Zidane, der spielte wie in besten Zeiten, gab es keine herausragende Einzelleistung mehr. Stattdessen wurde deutlich, daß hier schon die ganze Zeit keine Mannschaft auf dem Feld gestanden hatte, sondern ein zusammengewürfelte Mischung von einzelnen Stars und einer Reihe sehr guter Spieler, die nie zu einer Mannschaft zusammengefunden hatte.
So sehr im Fußball individuelles Können unabdingbar ist, so sehr ist und bleibt es doch ein kollektiver Sport, der nur auf Dauer zum Erfolg führen kann, wenn man zu einer Mannschaft zusammenwächst.
Das gleiche Problem, das auch Real Madrid nur zu gut kennt. Mit einer Anzahl von Welt-Stars wie keine andere Mannschaft glaubt man, den Erfolg kaufen zu können. Aber die alten Fußballweisheiten sagen: Mehr als zwei Stars verträgt keine Mannschaft – und die müssen noch in verschiedenen Mannschaftsteilen spielen. Eine Ausnahme war Deutschland 1974 mit drei Stars: dem Torwart Sepp Maier, dem Libero Franz Beckenbauer und dem Sturmführer Gerd Müller – in drei Mannschaftsteilen.
Fast unheimlich, das Tabu der Kontinente. (Fast) nie gewinnt eine Mannschaft vom anderen Kontinent – was die beiden hauptsächlichen Fußballkontinente Südamerika und Europa betrifft. Nur ein einziges Mal gab es bisher eine Ausnahme von dieser Regel: In Schweden 1958, als Brasilien auf dem europäischen Kontinent Weltmeister wurde – das war aber auch eine Ausnahmemannschaft.
Seitdem, wie auch schon vorher, haben bei Weltmeisterschaften auf dem europäischen Kontinent immer europäische Mannschaften gewonnen (1966: England, 1974: Deutschland, 1982: Italien, 1990: Deutschland, 1998: Frankreich), ja bei mehreren dieser Gelegenheiten waren alle vier Mannschaften im Halbfinale Europäer (1966, 1982, 2006).
Umgekehrt haben bei allen Weltmeisterschaften auf dem amerikanischen Kontinent immer südamerikanische Mannschaften gewonnen: 1930 in Uruguay: Uruguay, 1950 in Brasilien: Uruguay, 1962 in Chile: Brasilien, 1970 in Mexiko: Brasilien, 1978 in Argentinien: Argentinien, 1986 in Mexiko: Argentinien, 1994 in den USA: Brasilien.
So wird es nach dieser Weltmeisterschaft, die wieder ein europäisches Team siegen sehen wird, zwischen Europa und Südamerika nach 18 Weltmeisterschaften 9 : 9 stehen.
Allerdings sieht es für die 8 Jahre danach wieder schwarz aus für europäische Mannschaften: Die nächste Weltmeisterschaft wird in Südafrika sein, die darauffolgende in Südamerika, voraussichtlich Brasilien.
Das lange Aufarbeiten
Inzwischen hat in Brasilien bereits die Aufarbeitung begonnen, die üblicherweise vier Jahre dauert. Sündenböcke werden gesucht und gefunden. Der erste ist meistens der Trainer. Es steht praktisch schon fest, daß Carlos Alberto Parreira nicht weitermachen wird. Besonnenere Beobachter weisen aber darauf hin, daß es die Spieler auf dem Platz waren, die das Spiel verloren haben. Tatsache bleibt, daß der Trainer der
Hauptverantwortliche ist, wenn keine Mannschaft geformt wird.
Seine Erklärungen nach Spielende waren völlig unzureichend. Er sah das einzige Problem in der Szene, als das französische Tor fiel. So als ob die Franzosen nicht eine Reihe von Chancen gehabt hätten. So als ob nicht alle gesehen hätten, daß alle brasilianischen Stars weit unter ihren Möglichkeiten blieben.
Tatsächlich aber, und das haben inzwischen fast alle Brasilianer minutiös in Zeitlupe am Fernsehen verfolgen können, war das Verhalten von Roberto Carlos in der Szene mit dem Tor absolut unverständlich. Während Zidane anläuft, um den Freistoß zu schießen, steht er neben Thierry Henri, für dessen Deckung er also in diesem Moment zuständig ist. Er beugte sich nach vorne – aus Gründen, die niemand weiß – und als der Ball geschossen wird und alle in Richtung der Flugbahn des Balles rennen, der ganz nahe vor dem Tor herunterkommt, bleibt er wie angewurzelt dort am Strafraumrand stehen, wo beide vorher standen. Henry läuft also völlig ungedeckt in die Flugbahn und hat keinerlei Schwierigkeiten, mit dem Fuß zu verwandeln.
Roberto Carlos wird mit Sicherheit nicht mehr in der brasilianischen Mannschaft spielen. Auch Cafú hat nun, mit 36 Jahren, ausgedient. Was mit Ronaldo sein wird, weiß niemand. Auch ein Emerson ist sicher nicht mehr im Aufgebot.
Es wird bereits heftig über einen Namen für den Trainer diskutiert, aber das alles wird Zeit in Anspruch nehmen. Zagallo, der noch als eine Art von Trainer-Assistent diente, wird wohl ebenfalls endgültig beim alten Eisen landen.
Auch die Diskussionen um den Nike-Vertrag der CBF, des brasilianischen Fußballverbandes, kommen wieder auf, wie schon nach 1998. Fest steht, die CBF hat einen Millionenvertrag mit Nike, wohin das Geld fließt, wissen die Götter. Der Vertrag wurde nie offen gelegt. Nachdem man nach dem Anfall von Ronaldo vor dem Finale von 1998 einen Nike-Vertreter heftig mit den Verantwortlichen diskutieren sah, hält sich das Gerücht, Nike habe Anteil an der Aufstellung der Mannschaft. Die Firma habe damals durchgesetzt, daß Ronaldo für das Endspiel auflief, obwohl er offensichtlich ungeklärte gesundheitliche Probleme hatte.
Nike hat auch Verträge mit Einzelspielern, darunter Ronaldo, Ronaldinho und Roberto Carlos. Es wird in Brasilien kolportiert, Nike hätte die Aufstellung Roberto Carlos erzwungen, obwohl er sichtbar außer Form war (oder vielleicht auch unwillig).
Wie auch immer, die WM geht weiter. Nach der Leistung gegen Brasilien ist Frankreich Top-Favorit. Aber man wird weder Zidane noch Henry erneut soviel Raum lassen wie es die Brasilianer taten. Man wird sie liebevoll in Manndeckung nehmen und sie werden damit an Effizienz verlieren. Als Parreira nach dem Spiel gefragt wurde, warum er keine Manndeckung für Zidane vorgesehen hatte, antwortete er: „Brasilien kennt traditionell keine Manndeckung."
Nun, das trifft weder auf Portugal zu noch auf die eventuellen Endspielgegner Italien oder Deutschland. Wenn bei dieser Weltmeisterschaft alles so läuft wie immer, dann dürfte die deutsche Mannschaft keine Chance gegen Italien haben. In Weltmeisterschaften hat Deutschland nie gegen Italien gewonnen. Allerdings kam es auch noch nie zu einem Elfmeterschießen zwischen beiden.
Sicherlich um die 90 % der Brasilianer haben das Spiel am Fernsehen verfolgt. Auch die Frauen, die sonst nicht so um Fußball besorgt sind, sitzen oder stehen bei einer ‚copa’, wie hier die Weltmeisterschaft heißt, vor dem Fernseher. Niemand konnte also verhüllen, was wirklich geschah: Frankreich war, wie schon im Finale von 1998, weit überlegen. Wäre den Brasilianern im Schlußansturm wirklich noch der Ausgleich gelungen und sie hätten eventuell das Elfmeterschießen gewonnen, wäre das ungerecht gewesen. Dabei kann man nicht einfach individuelles Versagen einzelner Spieler verantwortlich machen, sondern muß die ganze Mannschaft sehen - es gab nämlich keine Mannschaft.
Für eine kurze, aber oft glückliche Zeit ist der Brasilianer während der WM seinen Alltagsproblemen entrückt, so wie das auch im ‚Carnaval’ der Fall ist. Geht alles glücklich aus, so wie 2002, hat man einen zweiten Karneval mitten im Jahr. Aber es kann eben immer nur einer gewinnen und das ist in der überwiegenden Zahl der WMs nicht Brasilien – speziell, wenn sie in Europa ausgetragen wird.
Schweigen im Schock
So wie schon 1990 und 1998, als man ebenfalls in Spielen mit indiskutabler Leistung ausschied, macht sich dann ein Schock breit im großen südamerikanischen Land, der hauptsächlich durch Schweigen charakterisiert ist. Danach, langsam, setzt sich die Trauer durch, dann kommt die Wut auf alles, was verantwortlich gemacht werden könnte und schließlich läuft es in einer tiefen Resignation aus.
Die Probleme des Lebens in Brasilien drücken mit doppelter Wucht, können noch weniger als schon normal zur Seite geschoben werden. Die Last, die brasilianische Oligarchie auf den Schultern tragen zu müssen, verdreifacht sich. Die absurde Bürde von hohen und immer höheren Steuern (fast alle Produkte haben mehr als 50% Steuerlast im Preis), um den imperialistischen Schuldnerländern und –banken die Zinsen bezahlen zu können, wird wieder schmerzlich bewußt.
Haben die brasilianischen Stars, einschließlich Ronaldinho, dem ‚Besten der Welt’, plötzlich Fußballspielen verlernt? Sicher nicht. In den vorhergehenden Spielern hatten Einzelleistungen von einigen Spielern noch das Sichtbarwerden der mangelnden Mannschaftsleistung verhindert. Doch diesmal, gegen einen Gegner, der in Hochform spielte und sowieso eine Klasse-Elf darstellt, gegen einen Zinedine Zidane, der spielte wie in besten Zeiten, gab es keine herausragende Einzelleistung mehr. Stattdessen wurde deutlich, daß hier schon die ganze Zeit keine Mannschaft auf dem Feld gestanden hatte, sondern ein zusammengewürfelte Mischung von einzelnen Stars und einer Reihe sehr guter Spieler, die nie zu einer Mannschaft zusammengefunden hatte.
So sehr im Fußball individuelles Können unabdingbar ist, so sehr ist und bleibt es doch ein kollektiver Sport, der nur auf Dauer zum Erfolg führen kann, wenn man zu einer Mannschaft zusammenwächst.
Das gleiche Problem, das auch Real Madrid nur zu gut kennt. Mit einer Anzahl von Welt-Stars wie keine andere Mannschaft glaubt man, den Erfolg kaufen zu können. Aber die alten Fußballweisheiten sagen: Mehr als zwei Stars verträgt keine Mannschaft – und die müssen noch in verschiedenen Mannschaftsteilen spielen. Eine Ausnahme war Deutschland 1974 mit drei Stars: dem Torwart Sepp Maier, dem Libero Franz Beckenbauer und dem Sturmführer Gerd Müller – in drei Mannschaftsteilen.
Fast unheimlich, das Tabu der Kontinente. (Fast) nie gewinnt eine Mannschaft vom anderen Kontinent – was die beiden hauptsächlichen Fußballkontinente Südamerika und Europa betrifft. Nur ein einziges Mal gab es bisher eine Ausnahme von dieser Regel: In Schweden 1958, als Brasilien auf dem europäischen Kontinent Weltmeister wurde – das war aber auch eine Ausnahmemannschaft.
Seitdem, wie auch schon vorher, haben bei Weltmeisterschaften auf dem europäischen Kontinent immer europäische Mannschaften gewonnen (1966: England, 1974: Deutschland, 1982: Italien, 1990: Deutschland, 1998: Frankreich), ja bei mehreren dieser Gelegenheiten waren alle vier Mannschaften im Halbfinale Europäer (1966, 1982, 2006).
Umgekehrt haben bei allen Weltmeisterschaften auf dem amerikanischen Kontinent immer südamerikanische Mannschaften gewonnen: 1930 in Uruguay: Uruguay, 1950 in Brasilien: Uruguay, 1962 in Chile: Brasilien, 1970 in Mexiko: Brasilien, 1978 in Argentinien: Argentinien, 1986 in Mexiko: Argentinien, 1994 in den USA: Brasilien.
So wird es nach dieser Weltmeisterschaft, die wieder ein europäisches Team siegen sehen wird, zwischen Europa und Südamerika nach 18 Weltmeisterschaften 9 : 9 stehen.
Allerdings sieht es für die 8 Jahre danach wieder schwarz aus für europäische Mannschaften: Die nächste Weltmeisterschaft wird in Südafrika sein, die darauffolgende in Südamerika, voraussichtlich Brasilien.
Das lange Aufarbeiten
Inzwischen hat in Brasilien bereits die Aufarbeitung begonnen, die üblicherweise vier Jahre dauert. Sündenböcke werden gesucht und gefunden. Der erste ist meistens der Trainer. Es steht praktisch schon fest, daß Carlos Alberto Parreira nicht weitermachen wird. Besonnenere Beobachter weisen aber darauf hin, daß es die Spieler auf dem Platz waren, die das Spiel verloren haben. Tatsache bleibt, daß der Trainer der
Hauptverantwortliche ist, wenn keine Mannschaft geformt wird.
Seine Erklärungen nach Spielende waren völlig unzureichend. Er sah das einzige Problem in der Szene, als das französische Tor fiel. So als ob die Franzosen nicht eine Reihe von Chancen gehabt hätten. So als ob nicht alle gesehen hätten, daß alle brasilianischen Stars weit unter ihren Möglichkeiten blieben.
Tatsächlich aber, und das haben inzwischen fast alle Brasilianer minutiös in Zeitlupe am Fernsehen verfolgen können, war das Verhalten von Roberto Carlos in der Szene mit dem Tor absolut unverständlich. Während Zidane anläuft, um den Freistoß zu schießen, steht er neben Thierry Henri, für dessen Deckung er also in diesem Moment zuständig ist. Er beugte sich nach vorne – aus Gründen, die niemand weiß – und als der Ball geschossen wird und alle in Richtung der Flugbahn des Balles rennen, der ganz nahe vor dem Tor herunterkommt, bleibt er wie angewurzelt dort am Strafraumrand stehen, wo beide vorher standen. Henry läuft also völlig ungedeckt in die Flugbahn und hat keinerlei Schwierigkeiten, mit dem Fuß zu verwandeln.
Roberto Carlos wird mit Sicherheit nicht mehr in der brasilianischen Mannschaft spielen. Auch Cafú hat nun, mit 36 Jahren, ausgedient. Was mit Ronaldo sein wird, weiß niemand. Auch ein Emerson ist sicher nicht mehr im Aufgebot.
Es wird bereits heftig über einen Namen für den Trainer diskutiert, aber das alles wird Zeit in Anspruch nehmen. Zagallo, der noch als eine Art von Trainer-Assistent diente, wird wohl ebenfalls endgültig beim alten Eisen landen.
Auch die Diskussionen um den Nike-Vertrag der CBF, des brasilianischen Fußballverbandes, kommen wieder auf, wie schon nach 1998. Fest steht, die CBF hat einen Millionenvertrag mit Nike, wohin das Geld fließt, wissen die Götter. Der Vertrag wurde nie offen gelegt. Nachdem man nach dem Anfall von Ronaldo vor dem Finale von 1998 einen Nike-Vertreter heftig mit den Verantwortlichen diskutieren sah, hält sich das Gerücht, Nike habe Anteil an der Aufstellung der Mannschaft. Die Firma habe damals durchgesetzt, daß Ronaldo für das Endspiel auflief, obwohl er offensichtlich ungeklärte gesundheitliche Probleme hatte.
Nike hat auch Verträge mit Einzelspielern, darunter Ronaldo, Ronaldinho und Roberto Carlos. Es wird in Brasilien kolportiert, Nike hätte die Aufstellung Roberto Carlos erzwungen, obwohl er sichtbar außer Form war (oder vielleicht auch unwillig).
Wie auch immer, die WM geht weiter. Nach der Leistung gegen Brasilien ist Frankreich Top-Favorit. Aber man wird weder Zidane noch Henry erneut soviel Raum lassen wie es die Brasilianer taten. Man wird sie liebevoll in Manndeckung nehmen und sie werden damit an Effizienz verlieren. Als Parreira nach dem Spiel gefragt wurde, warum er keine Manndeckung für Zidane vorgesehen hatte, antwortete er: „Brasilien kennt traditionell keine Manndeckung."
Nun, das trifft weder auf Portugal zu noch auf die eventuellen Endspielgegner Italien oder Deutschland. Wenn bei dieser Weltmeisterschaft alles so läuft wie immer, dann dürfte die deutsche Mannschaft keine Chance gegen Italien haben. In Weltmeisterschaften hat Deutschland nie gegen Italien gewonnen. Allerdings kam es auch noch nie zu einem Elfmeterschießen zwischen beiden.
sfux - 3. Jul, 08:22 Article 1479x read