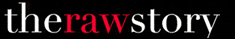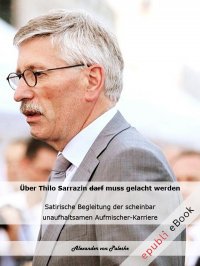Bajonette und Minarette - Das politische System der Türkei
Malte Olschewski - Die Türkei unterscheidet sich in ihrem politischen System ganz wesentlich von westeuropäischen Demokratien. Die wachsende Kraft des Islams und die politischen Ansprüche der 15 Millionen Kurden haben zu einer Abwehrfront von Militär, Justiz und Verwaltung geführt, die sich in den für 22.7.2007 geplanten Neuwahlen behaupten muss. Die regierende Islamistenpartei AKP (Entwicklungs- und Gerechtigkeitspartei) konnte ihren Kandidaten, Aussenminister Abdullah Gül, in zwei Parlamentsabstimmungen nicht durch-bringen. Die Aussicht, dass neben Ministerpräsident Recep Erdogan ein Islamist die höchste Position im Staat einnimmt, hatte zu einer Putschdrohung des Militärs und zu massenhaften Demonstrationen geführt.

Erdogan - wird verdächtigt eine "geheime grüne Agenda" zu haben
Nun will die Islampartei ein ganzes Paket von Änderungen zur Behauptung ihrer Herrschaft verabschieden. Sie will als wichtigste Massnahme, dass gleichzeitig mit dem Urnengang für das Parlament auch der Staatspräsident vom Volk gewählt wird. Weiter soll seine Amtszeit von sieben auf fünf Jahre verkürzt werden. Das Wahlalter soll wie das Quorum im Parlament gesenkt werden. Dazu aber ist eine Verfassungsänderung notwendig, die nach einer ersten Lesung zweimal mit einer Zweidrittelmehrheit verabschiedet werden muss. Dann kann der Präsident sein Veto einlegen. Beharrt das Parlament, so kann der Staatschef eine Volksabstimmung ausschreiben. Doch die Amtszeit des kemalistisch orientierten Präsidenten Ahmed Sezer endet am 16.5.2007. Die Türkei verliert sich in einem Irrgarten konstitutioneller Fragen. Bajonette werden gegen Minarette gerichtet. Die von den Militärs nach dem Putsch von 1980 eingeleitete „türkisch-islamische Synthese“, die Religion und Nationalismus verbinden sollte, ist endgültig gescheitert.
Seit 1945 über vierzig kommunistische Parteien
Die Ursache der politischen Wirrungen in der Türkei liegt eindeutig in der Klausel von zehn Prozent für einen Einzug in die Nationalversammlung. Diese Hürde war zusammen mit der Sitzverteilung ursprünglich gegen eine grosse, vereinigte Partei der Kurden gedacht. Die türkischen Kurden, wiewohl niemals genau gezählt, sollen heute rund 20 Prozent der Gesamtbevölkerung, das wären etwa 15 Millionen Menschen, ausmachen. So kam die prokurdische HADEP bei den Wahlen von 1999 landesweit 4,7 Prozent der Stimmen nicht in die Volksversammlung, obwohl sie in elf Ostprovinzen auf über 50 Prozent kam. Die Zehnprozenthürde kann auch als eine Massnahme gegen den türkischen Volkssport der Parteigründung angesehen werden. Derzeit sind über fünfzig Parteien registriert. Seit 1945 sind in der Türkei über vierzig kommunistische Parteien gegründet worden.
Die Hürde von zehn Prozent führte auch zu dem Wahlergebnis von 2002. Die AKP stellte mit 34,4 Prozent der Stimmen anfänglich 365 der 550 Abgeordneten. Die nichtreligiöse, sozialdemokratische „Republikanische Volks-Partei“ (CHP), die mit neun Prozent bei den Wahlen von 1999 gar nicht im Parlament vertreten war, hatte anfangs mit 19,5 Prozent 177 Mandatare. Keine andere Partei kam ins Parlament. Durch das ausgeprägte Klientelwesen kommt es aber regelmässig zum so genannten Parteientransfer.
Dem Abgeordneten sind Vorteile für sich, seine Familie und seinen Wahlkreis wichtiger als die Treue zu einer Partei. Bis März 2007 sind der AKP 13 und der CHT 22 Mandatare abhanden gekommen. Ohne gewählt worden zu sein, bildete sich nur durch Abtrünnige die „Mutterlandspartei“ (ANAP: 2002 „ 5.1 Prozent) mit zwanzig Abgeordneten. Die „Partei des rechten Weges „ (DYP „ 2002: 9,5 Prozent) rekrutierte sich aus fünf Überläufern. Daneben sitzen noch drei Einmannparteien im Parlament. Zwischen 1999 und 2002 hatten sogar 71 Abgeordnete, das sind 13 Prozent aller Mandatare, die Partei gewechselt. Ein Volksvertreter erzielte Weltrekord, indem er sieben Mal zwischen den Parteien unterwegs war.
„Grüne“ Banken, Meer von Kopftüchern und andere Phänomene
Das nach Europa projizierte Image der AKP als eine gemässigte, religiös orientierte Partei, wie etwa die CDU in Deutschland, ist ein Trugbild. Die islamistische Bewegung hat sich durch einen Jahrzehnte langen Kampf mit dem Militär und den Verfassungsorganen derart fein abgeschliffen, dass sie nun als eine Allzweckpartei auftreten kann. Aber sie hat, wo immer sie an der Macht war, ihre religiösen Prinzipien durchgesetzt. Das Militär hat eine Fülle von Beweisen gesammelt, dass in der Türkei seit 2002 eine Islamisierung läuft. Erdogan und Gül werden verdächtigt, eine „geheime, grüne Agenda“ zu haben.
In Dörfern und Kleinstädten ist der Trend stärker als in den Urlaubszentren an der Küste: Alkoholverbot durch extreme Steuern, ein wogendes Meer von Kopftüchern, Arabischkurse, Neubau von Moscheen, „grüne“ Banken und andere Phänomene beweisen nicht nur den kemalistischen Generälen den Aufbau einer religiösen Parallelgesellschaft. Das türkische Militär sieht sich zusammen mit der Justiz als Hüter der laizistischen Verfassung und als Erbe des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk: Staat und Religion müssen scharf getrennt bleiben.
Erdogan und Gül hatten einander beim Aufstieg der mehrmals umbenannten Islamistenpartei einander wechselseitig ersetzt und ergänzt. War Erdogan durch Politikverbot oder Haftstrafe behindert, so durfte Gül an seine Stelle treten. Dass nun Gül Staatschef mit wesentlich grösserer Machtfülle als Präsidenten in Europa werden soll, hat nicht nur das Militär alarmiert. Das türkische Militär hat seit Staatgründung der Republik durch Mustafa Kemal 1923 die Politik kontrolliert und mitbestimmt. 1960 wurde Ministerpräsident Adnan Menderes in einem Putsch gestürzt, verurteilt und auch gehenkt. 1971 putschte das Militär neuerlich und liess erst nach drei Jahren wieder Wahlen zu. Als rechtsradikale und kommunistische Bewegungen einander bekämpften, kam es am 12.9.1980 zu einem weiteren Staatsstreich unter Miltärchef Kenan Evren. Parteien wurden verboten. 1 500 Personen wurden vor Gericht gestellt. Etwa 30 000 Menschen verloren ihren Beruf. Es soll 150 Tote allein durch Folter gegeben haben. Das Militär war diskreditiert.
Politischer Vormarsch der Islamisten
1983 folgten Neuwahlen. Damals begannen die Islamisten ihren politischen Vormarsch. Als Nemcettin Erbakan durch geschicktes Koalieren im Regenwald der Parteien Regierungschef wurde und die Islamisierung vorantrieb, setzte das Militär 1997 seinen verlängerten Arm im Nationalen Sicherheitsrat ein. In einem „kalten Putsch“ und ohne rollende Panzer erzwangen die Gene-räle den Rücktritt Erbakans, des politischen Ziehvaters von Erdogan und Gül.
Dieser durch die Verfassung von 1982 geschaffene Rat hatte mit der Mehrheit der Militärs unter seinen Mitgliedern eine bestimmende Funktion. Mit 352 Abgeordneten im Rücken hat Erdogan die Entmachtung dieses Gremiums im sieben-ten “Anpassungspaket“ zur EU versteckt. Von Brüssel wird die Auschaltung des Militärs verlangt, wiewohl in erster Linie die Generäle die ebenfalls von der EU gewünschte, laizistische Ordnung garantieren.
Die EU wünscht aber auch keine Islamisierung. Wie es scheint, sind ihr aalglatte Islamisten lieber als politisierende Generäle. Mit Parlamentsmehrheit wurde im „Anpassungspaket“ dem Sicherheitsrat nur mehr eine „beratende“ Funktion zugebilligt. Ausserdem ist seine Zusammensetzung so verändert worden, dass die Generäle über diese Schiene kaum mehr Einfluss haben. Als Gegenreaktion sind im Militär die Hardliner in führende Positionen gelangt. Generalstabschef Yasar Büyükanit hatte sich in seiner ganzen Karriere als Verteidiger der Trennung von Staat und Religion erwiesen.
Der “@-Putsch“ am 1.5.07
Im Gegensatz zu bisherigen zögerlichen und übervorsichtigen Armeeführern ist er ein Mann, dem ein neuer Putsch zuzutrauen ist. Er hat Verbindungen in alle Richtungen aufgebaut. Per Internet mit Absender „Der türkische Generalstab“ liess er in einem so genannten „@-Putsch“ am 1.5.2007 wissen, dass die Armee ihren Verpflichtungen nachkommen werde. Das hiess: Die Armee wird Abdullah Gül als Staatspräsidenten, sollte er bei Volkswahlen kandidieren und gewinnen, notfalls mit einem Putsch verhindern.
Es eilte in dieser kritischen Situation der EU-Beauftragte Xavier Solana herbei, um Aussenminister Gül bei seiner Kandidatur für das oberste Amts mit den Floskeln zu unterstützen, die eine geringe Kenntnis der tieferen Gründe verrieten. Statt unerträglicher Lobeshymnen für den ständig lächelnden Gül hätte Solana auch sagen können: „Die EU wünscht eine Aufhebung der Zehnprozentklausel!“ Da Solana und Gül einander so herzlich umarmten, demonstrierten in Istanbul eine Millionen Menschen mit den Parolen: „Kein Putsch! Keine Scharia! Weg mit der EU! Weg mit den USA!“
Am 27.4. schritt die Volksvertetung in Ankara zur Wahl des neuen Staatspräsidenten, bei der Abdullah Gül als einziger Kandidaten nominiert worden war. In den ersten beiden Durchgängen ist dabei eine Zweidrittelmehrheit notwendig, in den beiden folgenden Abstimmungen genügt die absolute Mehrheit. Die Opposition boykottierte die Wahl. Es waren nur 361 Abgeordnete, davon 352 von der AKP, anwesend. Damit war die notwendige Zweidrittelmehrheit von 367 Stimmen von vornherein nicht gegeben. Die oppositionelle CHT klagte trotz Scheiterns der AKP beim Verfassungsgericht wegen des fehlenden Quorums, das ist die notwendigen Anwesenheit von Parlamentariern.
Ein höchst komplizierter Verfassungsstreit
Das Gericht ist seit Staatsgründung in Händen der Kemalisten. Obwohl kein Ergebnis vorlag, wurde der erste Wahlgang annulliert. Es entwickelte sich ein höchst komplizierter Verfassungsstreit und ein Kampf um das Quorum. Was soll geschehen, wenn bei einer vorgeschrieben Zweidrittelmehrheit keine zwei Drittel der Parlamentarier anwesend sind? Im zweiten Durchgang am 2.5.2007 stellte Parlamentspräsident Erinc die Anwesenheit von 356 Abgeordneten fest. Eine zweite Zählung nach zehn Minuten ergab 358 Parlamentarier, das waren neun weniger als notwendig. Das war das Ende der Sitzung.
Man eilte in die Ausschüsse. Die AKP brachte sieben Anträge auf Änderung der Verfassung ein, darunter jenen auf Volkswahl des Präsidenten. Die oppositionelle CHP stellte fest, dass laut Artikel 121 der parlamentarischen Geschäftsordnung bei Verabschiedung von Gesetzen und damit auch bei der Wahl des Präsidenten eine Anwesenheit von zwei Dritteln der Abgeordneten notwendig sei. Die AKP entgegnete, laut Artikel 102 der Verfassung werde bei der Wahl des Präsidenten kein Quorum vorgeschrieben. Es seien auch vergangene Präsidenten oft nur bei Anwesenheit von 200 bis 300 Abgeordneten gewählt worden. Schliesslich einigte man sich auf Neuwahlen des Parlamentes am 22.7.2007.
Die AKP wollte eine unweigerlich folgende Neuordnung der Parteienlandschaft mit einem früheren Termin unterlaufen, kam aber damit nicht durch. Jetzt beginnen neue Hochzeiten unter den Parteien. Man vereinigt sich, um die zehn Prozent gemeinsam zu überspringen. Wenn dieser Schritt gelingt, so kann man mit vielen Madataren in der Nationalversammlung rechnen. Stimmen werden gekauft und hinzugekauft. Klans und Klienten rotieren. Allianzen überschlagen sich. Die CHP will sich durch die Inhalation kleinerer Linksparteien stärken. Die Konservativen, die bei den letzten Wahlen so schmachvoll untergegangen waren, kaufen sich eine neue Allianz zusammen.
Je mehr Parteien über die Hürde kommen, umso schlimmer werden die Islamisten im Parlament verkürzt. Doch auch die Islamisten haben in den fünf Jahren Regierungszeit genug Gelder beiseite geschafft, um einkaufen zu gehen im Basar der Stimmen. Die AKP ist guten Mutes und verweist auf ihre Wirtschaftsdaten. Dies aber sind Daten der Globalisierung, in denen eine kleine Klasse von Gewinnern und ungeheure Massen von Verlierern verschlüsselt sind. Die Islamisten hoffen auf mehr als 34 Prozent, doch hängt alles davon ab, ob und wer über die Hürde springen wird. In der Türkei hat es schon mehrmals bei Wahlen dramatische Abstürze und Aufstiege gegeben. Das kann auch am 22.7. geschehen.

Erdogan - wird verdächtigt eine "geheime grüne Agenda" zu haben
Nun will die Islampartei ein ganzes Paket von Änderungen zur Behauptung ihrer Herrschaft verabschieden. Sie will als wichtigste Massnahme, dass gleichzeitig mit dem Urnengang für das Parlament auch der Staatspräsident vom Volk gewählt wird. Weiter soll seine Amtszeit von sieben auf fünf Jahre verkürzt werden. Das Wahlalter soll wie das Quorum im Parlament gesenkt werden. Dazu aber ist eine Verfassungsänderung notwendig, die nach einer ersten Lesung zweimal mit einer Zweidrittelmehrheit verabschiedet werden muss. Dann kann der Präsident sein Veto einlegen. Beharrt das Parlament, so kann der Staatschef eine Volksabstimmung ausschreiben. Doch die Amtszeit des kemalistisch orientierten Präsidenten Ahmed Sezer endet am 16.5.2007. Die Türkei verliert sich in einem Irrgarten konstitutioneller Fragen. Bajonette werden gegen Minarette gerichtet. Die von den Militärs nach dem Putsch von 1980 eingeleitete „türkisch-islamische Synthese“, die Religion und Nationalismus verbinden sollte, ist endgültig gescheitert.
Seit 1945 über vierzig kommunistische Parteien
Die Ursache der politischen Wirrungen in der Türkei liegt eindeutig in der Klausel von zehn Prozent für einen Einzug in die Nationalversammlung. Diese Hürde war zusammen mit der Sitzverteilung ursprünglich gegen eine grosse, vereinigte Partei der Kurden gedacht. Die türkischen Kurden, wiewohl niemals genau gezählt, sollen heute rund 20 Prozent der Gesamtbevölkerung, das wären etwa 15 Millionen Menschen, ausmachen. So kam die prokurdische HADEP bei den Wahlen von 1999 landesweit 4,7 Prozent der Stimmen nicht in die Volksversammlung, obwohl sie in elf Ostprovinzen auf über 50 Prozent kam. Die Zehnprozenthürde kann auch als eine Massnahme gegen den türkischen Volkssport der Parteigründung angesehen werden. Derzeit sind über fünfzig Parteien registriert. Seit 1945 sind in der Türkei über vierzig kommunistische Parteien gegründet worden.
Die Hürde von zehn Prozent führte auch zu dem Wahlergebnis von 2002. Die AKP stellte mit 34,4 Prozent der Stimmen anfänglich 365 der 550 Abgeordneten. Die nichtreligiöse, sozialdemokratische „Republikanische Volks-Partei“ (CHP), die mit neun Prozent bei den Wahlen von 1999 gar nicht im Parlament vertreten war, hatte anfangs mit 19,5 Prozent 177 Mandatare. Keine andere Partei kam ins Parlament. Durch das ausgeprägte Klientelwesen kommt es aber regelmässig zum so genannten Parteientransfer.
Dem Abgeordneten sind Vorteile für sich, seine Familie und seinen Wahlkreis wichtiger als die Treue zu einer Partei. Bis März 2007 sind der AKP 13 und der CHT 22 Mandatare abhanden gekommen. Ohne gewählt worden zu sein, bildete sich nur durch Abtrünnige die „Mutterlandspartei“ (ANAP: 2002 „ 5.1 Prozent) mit zwanzig Abgeordneten. Die „Partei des rechten Weges „ (DYP „ 2002: 9,5 Prozent) rekrutierte sich aus fünf Überläufern. Daneben sitzen noch drei Einmannparteien im Parlament. Zwischen 1999 und 2002 hatten sogar 71 Abgeordnete, das sind 13 Prozent aller Mandatare, die Partei gewechselt. Ein Volksvertreter erzielte Weltrekord, indem er sieben Mal zwischen den Parteien unterwegs war.
„Grüne“ Banken, Meer von Kopftüchern und andere Phänomene
Das nach Europa projizierte Image der AKP als eine gemässigte, religiös orientierte Partei, wie etwa die CDU in Deutschland, ist ein Trugbild. Die islamistische Bewegung hat sich durch einen Jahrzehnte langen Kampf mit dem Militär und den Verfassungsorganen derart fein abgeschliffen, dass sie nun als eine Allzweckpartei auftreten kann. Aber sie hat, wo immer sie an der Macht war, ihre religiösen Prinzipien durchgesetzt. Das Militär hat eine Fülle von Beweisen gesammelt, dass in der Türkei seit 2002 eine Islamisierung läuft. Erdogan und Gül werden verdächtigt, eine „geheime, grüne Agenda“ zu haben.
In Dörfern und Kleinstädten ist der Trend stärker als in den Urlaubszentren an der Küste: Alkoholverbot durch extreme Steuern, ein wogendes Meer von Kopftüchern, Arabischkurse, Neubau von Moscheen, „grüne“ Banken und andere Phänomene beweisen nicht nur den kemalistischen Generälen den Aufbau einer religiösen Parallelgesellschaft. Das türkische Militär sieht sich zusammen mit der Justiz als Hüter der laizistischen Verfassung und als Erbe des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk: Staat und Religion müssen scharf getrennt bleiben.
Erdogan und Gül hatten einander beim Aufstieg der mehrmals umbenannten Islamistenpartei einander wechselseitig ersetzt und ergänzt. War Erdogan durch Politikverbot oder Haftstrafe behindert, so durfte Gül an seine Stelle treten. Dass nun Gül Staatschef mit wesentlich grösserer Machtfülle als Präsidenten in Europa werden soll, hat nicht nur das Militär alarmiert. Das türkische Militär hat seit Staatgründung der Republik durch Mustafa Kemal 1923 die Politik kontrolliert und mitbestimmt. 1960 wurde Ministerpräsident Adnan Menderes in einem Putsch gestürzt, verurteilt und auch gehenkt. 1971 putschte das Militär neuerlich und liess erst nach drei Jahren wieder Wahlen zu. Als rechtsradikale und kommunistische Bewegungen einander bekämpften, kam es am 12.9.1980 zu einem weiteren Staatsstreich unter Miltärchef Kenan Evren. Parteien wurden verboten. 1 500 Personen wurden vor Gericht gestellt. Etwa 30 000 Menschen verloren ihren Beruf. Es soll 150 Tote allein durch Folter gegeben haben. Das Militär war diskreditiert.
Politischer Vormarsch der Islamisten
1983 folgten Neuwahlen. Damals begannen die Islamisten ihren politischen Vormarsch. Als Nemcettin Erbakan durch geschicktes Koalieren im Regenwald der Parteien Regierungschef wurde und die Islamisierung vorantrieb, setzte das Militär 1997 seinen verlängerten Arm im Nationalen Sicherheitsrat ein. In einem „kalten Putsch“ und ohne rollende Panzer erzwangen die Gene-räle den Rücktritt Erbakans, des politischen Ziehvaters von Erdogan und Gül.
Dieser durch die Verfassung von 1982 geschaffene Rat hatte mit der Mehrheit der Militärs unter seinen Mitgliedern eine bestimmende Funktion. Mit 352 Abgeordneten im Rücken hat Erdogan die Entmachtung dieses Gremiums im sieben-ten “Anpassungspaket“ zur EU versteckt. Von Brüssel wird die Auschaltung des Militärs verlangt, wiewohl in erster Linie die Generäle die ebenfalls von der EU gewünschte, laizistische Ordnung garantieren.
Die EU wünscht aber auch keine Islamisierung. Wie es scheint, sind ihr aalglatte Islamisten lieber als politisierende Generäle. Mit Parlamentsmehrheit wurde im „Anpassungspaket“ dem Sicherheitsrat nur mehr eine „beratende“ Funktion zugebilligt. Ausserdem ist seine Zusammensetzung so verändert worden, dass die Generäle über diese Schiene kaum mehr Einfluss haben. Als Gegenreaktion sind im Militär die Hardliner in führende Positionen gelangt. Generalstabschef Yasar Büyükanit hatte sich in seiner ganzen Karriere als Verteidiger der Trennung von Staat und Religion erwiesen.
Der “@-Putsch“ am 1.5.07
Im Gegensatz zu bisherigen zögerlichen und übervorsichtigen Armeeführern ist er ein Mann, dem ein neuer Putsch zuzutrauen ist. Er hat Verbindungen in alle Richtungen aufgebaut. Per Internet mit Absender „Der türkische Generalstab“ liess er in einem so genannten „@-Putsch“ am 1.5.2007 wissen, dass die Armee ihren Verpflichtungen nachkommen werde. Das hiess: Die Armee wird Abdullah Gül als Staatspräsidenten, sollte er bei Volkswahlen kandidieren und gewinnen, notfalls mit einem Putsch verhindern.
Es eilte in dieser kritischen Situation der EU-Beauftragte Xavier Solana herbei, um Aussenminister Gül bei seiner Kandidatur für das oberste Amts mit den Floskeln zu unterstützen, die eine geringe Kenntnis der tieferen Gründe verrieten. Statt unerträglicher Lobeshymnen für den ständig lächelnden Gül hätte Solana auch sagen können: „Die EU wünscht eine Aufhebung der Zehnprozentklausel!“ Da Solana und Gül einander so herzlich umarmten, demonstrierten in Istanbul eine Millionen Menschen mit den Parolen: „Kein Putsch! Keine Scharia! Weg mit der EU! Weg mit den USA!“
Am 27.4. schritt die Volksvertetung in Ankara zur Wahl des neuen Staatspräsidenten, bei der Abdullah Gül als einziger Kandidaten nominiert worden war. In den ersten beiden Durchgängen ist dabei eine Zweidrittelmehrheit notwendig, in den beiden folgenden Abstimmungen genügt die absolute Mehrheit. Die Opposition boykottierte die Wahl. Es waren nur 361 Abgeordnete, davon 352 von der AKP, anwesend. Damit war die notwendige Zweidrittelmehrheit von 367 Stimmen von vornherein nicht gegeben. Die oppositionelle CHT klagte trotz Scheiterns der AKP beim Verfassungsgericht wegen des fehlenden Quorums, das ist die notwendigen Anwesenheit von Parlamentariern.
Ein höchst komplizierter Verfassungsstreit
Das Gericht ist seit Staatsgründung in Händen der Kemalisten. Obwohl kein Ergebnis vorlag, wurde der erste Wahlgang annulliert. Es entwickelte sich ein höchst komplizierter Verfassungsstreit und ein Kampf um das Quorum. Was soll geschehen, wenn bei einer vorgeschrieben Zweidrittelmehrheit keine zwei Drittel der Parlamentarier anwesend sind? Im zweiten Durchgang am 2.5.2007 stellte Parlamentspräsident Erinc die Anwesenheit von 356 Abgeordneten fest. Eine zweite Zählung nach zehn Minuten ergab 358 Parlamentarier, das waren neun weniger als notwendig. Das war das Ende der Sitzung.
Man eilte in die Ausschüsse. Die AKP brachte sieben Anträge auf Änderung der Verfassung ein, darunter jenen auf Volkswahl des Präsidenten. Die oppositionelle CHP stellte fest, dass laut Artikel 121 der parlamentarischen Geschäftsordnung bei Verabschiedung von Gesetzen und damit auch bei der Wahl des Präsidenten eine Anwesenheit von zwei Dritteln der Abgeordneten notwendig sei. Die AKP entgegnete, laut Artikel 102 der Verfassung werde bei der Wahl des Präsidenten kein Quorum vorgeschrieben. Es seien auch vergangene Präsidenten oft nur bei Anwesenheit von 200 bis 300 Abgeordneten gewählt worden. Schliesslich einigte man sich auf Neuwahlen des Parlamentes am 22.7.2007.
Die AKP wollte eine unweigerlich folgende Neuordnung der Parteienlandschaft mit einem früheren Termin unterlaufen, kam aber damit nicht durch. Jetzt beginnen neue Hochzeiten unter den Parteien. Man vereinigt sich, um die zehn Prozent gemeinsam zu überspringen. Wenn dieser Schritt gelingt, so kann man mit vielen Madataren in der Nationalversammlung rechnen. Stimmen werden gekauft und hinzugekauft. Klans und Klienten rotieren. Allianzen überschlagen sich. Die CHP will sich durch die Inhalation kleinerer Linksparteien stärken. Die Konservativen, die bei den letzten Wahlen so schmachvoll untergegangen waren, kaufen sich eine neue Allianz zusammen.
Je mehr Parteien über die Hürde kommen, umso schlimmer werden die Islamisten im Parlament verkürzt. Doch auch die Islamisten haben in den fünf Jahren Regierungszeit genug Gelder beiseite geschafft, um einkaufen zu gehen im Basar der Stimmen. Die AKP ist guten Mutes und verweist auf ihre Wirtschaftsdaten. Dies aber sind Daten der Globalisierung, in denen eine kleine Klasse von Gewinnern und ungeheure Massen von Verlierern verschlüsselt sind. Die Islamisten hoffen auf mehr als 34 Prozent, doch hängt alles davon ab, ob und wer über die Hürde springen wird. In der Türkei hat es schon mehrmals bei Wahlen dramatische Abstürze und Aufstiege gegeben. Das kann auch am 22.7. geschehen.
sfux - 9. Mai, 08:05 Article 2137x read