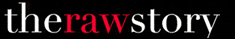Gewinner Obama, Verlierer Obama: Der nächste Präsident der USA
[Jörg Frh. v. Oldershausen] Am 4. November 2008 werden die Bürger dieses Landes den 111. Kongress und den 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten wählen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird dieser Barack Obama heißen. Eine Wahl mit historischer Relevanz, die ein stolzes Licht auf Amerikas Entwicklung und Toleranz werfen wird. Obama wird auf eine robuste Mehrheit der Demokraten im "House of Representatives" und möglicherweise auf Filibuster", also eine sichere Mehrheit von 60 Stimmen im Senat zählen können. Damit wird es zu einer kompletten Umkehrung der Machtverhältnisse kommen. Noch 2004 hielten die Republikaner Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses und stellten den Präsidenten.
Die Amerikaner sind sauer, stinksauer. Und sie sind demoralisiert und halten die derzeitige Regierung unter George W. Bush für die bestehende Misere verantwortlich. Reagon fragte einst die Amerikaner: "Steht ihr euch heute besser als vor vier Jahren?" und stellte sich mit diesen Worten als bessere Alternative gegen Carter zur Wahl. Eine solche Fragestellung wäre heute absurd und würde in wüsten Beschimpfung enden. Natürlich steht niemand besser da. Die Zeichen stehen auf Wechsel und die Republikaner stehen im Weg.
John McCain: Richtiger Kandidat zur falschen Zeit
Unter anderern Voraussetzungen und zu anderen Zeiten hätte John McCain durchaus eine gute Chance, die Wahl zu gewinnen. Der Kandidat aus den republikanischen Reihen ist moderater und unabhängiger als die meisten anderen Republikaner und durchaus Willens, trotz politisch hoher Kosten - Irak Surge, Immigranten - für seine Überzeugungen einzustehen. Das mag die republikanische Basis nicht erfreuen, aber so manchen Unabhängigen und verschnupften Demokraten, wie etwa Frauen, die auf Hillary setzen, einnehmen. Die Basis erhielt ihren extra Keks in der Form von Sarah Palin, die ihre Unerfahrenheit durch Sexappeal und Gusto mehr als ausgleichen konnte und neue Begeisterung für das "ticket" unter den Glaubenstreuen auslösen konnte. Die außergewöhnliche Lebensgeschichte John McCains, seine lange und harsche Gefangenschaft in Vietnam, seine militärische und politische Karriere, Charakter, ja auch sein explosives Temperament sind Legende und würden in jedem Wahlkampf einen positiven Unterschied machen. Nicht so dieses Mal. Das negative Gepäck der Republikaner mit seinem zutiefst unpopulären Präsidenten, der Krieg im Irak und nun einer Wirtschaft in Trümmern – dies alles wiegt zentnerschwer.
Obama, der geborene Politiker
Seit 20 Monaten kämpft Obama um die Präsidentschaft. Er darf vor allen Dingen Hillary danken, dass sie ihn gnadenlos über viele Monate hin herausgefordert und zu einem erstklassigen Wahlkämpfer gemacht hat. Schon Hillary hat trozt ihrer eigenen, großen Popularität feststellen müssen, dass Obama nicht zu unterschätzen ist. Sein Charisma, sein Appeal für die jüngere Generation und seine deliberate, von Taktik geprägte Strategie, übertrafen vermeintliche Nachteile wie Rasse, zweifehafte Förderer, eine – selbst für Amerikaner - fast exotische Lebensgeschichte und politische Unerfahrenheit. Mit Hilfe von David Axelrod, Penny Pritzker und David Plouffe hat Obama eine erstklassige, mit weit über 450 Millionen-Spenden gut finanzierte Organisation aufgebaut, die das Rückrad für die Wahlkampfmaschine des möglichen künftigen Präsidenten äußerst kräftig ölte. Seine verhaltene, eher studierte und ruhige Art Probleme anzugehen und zu artikulieren, findet in diesen turbulenten Zeiten besonderen Anklang.
In riesigen Arenen überzeugte Obama vor enormen Menschenmengen, von denen andere Politiker nur träumen können. Seine Reden inspirierten und zielten auf den Idealismus der Bürger. Sie waren speziell auf die Jugend ausgerichtet, ohne dabei politisch kalkulierend zu wirken. Mit einzigartigen Worten, die ihn über den Anspruch eines Politikers hinweghoben, stellte er sich den Herausforderungen, denen sich unsere Gesellschaft ausgesetzt sieht. Nach dem Gewinn der Primaries entwickelte sich ein mehr zentrisch liegender und praktischer Obama. Die Reden bezogen sich nun auf "Brot und Butter", Themen, politisch kalkulierend auf all jene Gruppierungen fokussiert, die er ansprechen wollte. Trotz seiner relativ kurzen Karriere in der Bundespolitik hat sich Obama zum formidablen Politiker gemausert. Er trägt den Mantel der Hoffnung und Hoffnung ist es, was das Land dringend braucht.
Warum Obama?
Die augenblicklichen Umfragen zeigen Obama zwischen vier und sieben Prozent vor McCain. Nicht ausreichend um den Ausgang dieser Wahl zu seinen Gunsten vorherzusagen. Die Umfragen täuschen jedoch, da sie bundesweit unter potentiellen Wählern gehalten wurden. Sie sind mehr oder weniger ein Popularitätskontest. Amerika hat ein indirektes Wahlsystem. Nicht der Wähler bestimmt den Präsidenten, sondern das "Electoral College". Jeder Bundesstaat bestimmt "„electors" entsprechend der Anzahl an Senatoren und Repräsentanten im "House". Zusammen mit Washington DC ergeben sich damit 538 Wahlmänner. 48 Bundesstaaten und Washington DC folgen der Regel: "the winner takes all". Nur Nebraska und Maine haben ein anderes System. Die Folge: Ganz gleich wieviele Stimmen der Verlierer in einem Bundesstaat erhält, sie zählen am Ende nicht. Alle möglichen Stimmen der "electors" gehen an den Gewinner. Es bedarf 270 "electoral votes", um die Wahl zu gewinnen. Analysiert man die Umfragen von Bundesstaat zu Bundesstaat, dann wird klar, dass es für McCain fast unmöglich ist, ausreichend "electoral votes" zu gewinnen.
Sieger Obama, Verlierer Obama
Fast kann man Mitleid mit dem Sieger und nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten haben. Der Krieg im Irak, die Krise im Gesundheitswesen, galoppierende Haushaltsdefizite, eine Staatsverschuldung die Neugeborenen graue Haare schafft, Rentenobligationen, Energiekrise und vieles mehr. Die Herausforderungen sind gigantisch und extraordinär. Und als ob dies an Problemen noch nicht ausreicht, befinden wir uns mittlerweile in einer Rezession und weltweiten Wirtschaftskrise, welche die Fähigkeit der amerikanischen Regierung hinsichtlich der vorgenannten Herausforderungen weiterhin einschränkt. Obama wird jeder in ihn gesetzten Hoffnung gerecht werden müssen, um den gigantischen Mist-Stall auch nur annähernd in den Griff zu bekommen. Republikaner und Demokraten beten gleichermaßen, dass er dieser Herausforderung gewachsen ist. Es geht um viel. Es geht um die Zukunft Amerikas.
Die Amerikaner sind sauer, stinksauer. Und sie sind demoralisiert und halten die derzeitige Regierung unter George W. Bush für die bestehende Misere verantwortlich. Reagon fragte einst die Amerikaner: "Steht ihr euch heute besser als vor vier Jahren?" und stellte sich mit diesen Worten als bessere Alternative gegen Carter zur Wahl. Eine solche Fragestellung wäre heute absurd und würde in wüsten Beschimpfung enden. Natürlich steht niemand besser da. Die Zeichen stehen auf Wechsel und die Republikaner stehen im Weg.
John McCain: Richtiger Kandidat zur falschen Zeit
Unter anderern Voraussetzungen und zu anderen Zeiten hätte John McCain durchaus eine gute Chance, die Wahl zu gewinnen. Der Kandidat aus den republikanischen Reihen ist moderater und unabhängiger als die meisten anderen Republikaner und durchaus Willens, trotz politisch hoher Kosten - Irak Surge, Immigranten - für seine Überzeugungen einzustehen. Das mag die republikanische Basis nicht erfreuen, aber so manchen Unabhängigen und verschnupften Demokraten, wie etwa Frauen, die auf Hillary setzen, einnehmen. Die Basis erhielt ihren extra Keks in der Form von Sarah Palin, die ihre Unerfahrenheit durch Sexappeal und Gusto mehr als ausgleichen konnte und neue Begeisterung für das "ticket" unter den Glaubenstreuen auslösen konnte. Die außergewöhnliche Lebensgeschichte John McCains, seine lange und harsche Gefangenschaft in Vietnam, seine militärische und politische Karriere, Charakter, ja auch sein explosives Temperament sind Legende und würden in jedem Wahlkampf einen positiven Unterschied machen. Nicht so dieses Mal. Das negative Gepäck der Republikaner mit seinem zutiefst unpopulären Präsidenten, der Krieg im Irak und nun einer Wirtschaft in Trümmern – dies alles wiegt zentnerschwer.
Obama, der geborene Politiker
Seit 20 Monaten kämpft Obama um die Präsidentschaft. Er darf vor allen Dingen Hillary danken, dass sie ihn gnadenlos über viele Monate hin herausgefordert und zu einem erstklassigen Wahlkämpfer gemacht hat. Schon Hillary hat trozt ihrer eigenen, großen Popularität feststellen müssen, dass Obama nicht zu unterschätzen ist. Sein Charisma, sein Appeal für die jüngere Generation und seine deliberate, von Taktik geprägte Strategie, übertrafen vermeintliche Nachteile wie Rasse, zweifehafte Förderer, eine – selbst für Amerikaner - fast exotische Lebensgeschichte und politische Unerfahrenheit. Mit Hilfe von David Axelrod, Penny Pritzker und David Plouffe hat Obama eine erstklassige, mit weit über 450 Millionen-Spenden gut finanzierte Organisation aufgebaut, die das Rückrad für die Wahlkampfmaschine des möglichen künftigen Präsidenten äußerst kräftig ölte. Seine verhaltene, eher studierte und ruhige Art Probleme anzugehen und zu artikulieren, findet in diesen turbulenten Zeiten besonderen Anklang.
In riesigen Arenen überzeugte Obama vor enormen Menschenmengen, von denen andere Politiker nur träumen können. Seine Reden inspirierten und zielten auf den Idealismus der Bürger. Sie waren speziell auf die Jugend ausgerichtet, ohne dabei politisch kalkulierend zu wirken. Mit einzigartigen Worten, die ihn über den Anspruch eines Politikers hinweghoben, stellte er sich den Herausforderungen, denen sich unsere Gesellschaft ausgesetzt sieht. Nach dem Gewinn der Primaries entwickelte sich ein mehr zentrisch liegender und praktischer Obama. Die Reden bezogen sich nun auf "Brot und Butter", Themen, politisch kalkulierend auf all jene Gruppierungen fokussiert, die er ansprechen wollte. Trotz seiner relativ kurzen Karriere in der Bundespolitik hat sich Obama zum formidablen Politiker gemausert. Er trägt den Mantel der Hoffnung und Hoffnung ist es, was das Land dringend braucht.
Warum Obama?
Die augenblicklichen Umfragen zeigen Obama zwischen vier und sieben Prozent vor McCain. Nicht ausreichend um den Ausgang dieser Wahl zu seinen Gunsten vorherzusagen. Die Umfragen täuschen jedoch, da sie bundesweit unter potentiellen Wählern gehalten wurden. Sie sind mehr oder weniger ein Popularitätskontest. Amerika hat ein indirektes Wahlsystem. Nicht der Wähler bestimmt den Präsidenten, sondern das "Electoral College". Jeder Bundesstaat bestimmt "„electors" entsprechend der Anzahl an Senatoren und Repräsentanten im "House". Zusammen mit Washington DC ergeben sich damit 538 Wahlmänner. 48 Bundesstaaten und Washington DC folgen der Regel: "the winner takes all". Nur Nebraska und Maine haben ein anderes System. Die Folge: Ganz gleich wieviele Stimmen der Verlierer in einem Bundesstaat erhält, sie zählen am Ende nicht. Alle möglichen Stimmen der "electors" gehen an den Gewinner. Es bedarf 270 "electoral votes", um die Wahl zu gewinnen. Analysiert man die Umfragen von Bundesstaat zu Bundesstaat, dann wird klar, dass es für McCain fast unmöglich ist, ausreichend "electoral votes" zu gewinnen.
Sieger Obama, Verlierer Obama
Fast kann man Mitleid mit dem Sieger und nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten haben. Der Krieg im Irak, die Krise im Gesundheitswesen, galoppierende Haushaltsdefizite, eine Staatsverschuldung die Neugeborenen graue Haare schafft, Rentenobligationen, Energiekrise und vieles mehr. Die Herausforderungen sind gigantisch und extraordinär. Und als ob dies an Problemen noch nicht ausreicht, befinden wir uns mittlerweile in einer Rezession und weltweiten Wirtschaftskrise, welche die Fähigkeit der amerikanischen Regierung hinsichtlich der vorgenannten Herausforderungen weiterhin einschränkt. Obama wird jeder in ihn gesetzten Hoffnung gerecht werden müssen, um den gigantischen Mist-Stall auch nur annähernd in den Griff zu bekommen. Republikaner und Demokraten beten gleichermaßen, dass er dieser Herausforderung gewachsen ist. Es geht um viel. Es geht um die Zukunft Amerikas.
Spreegurke - 16. Okt, 08:30 Article 2669x read