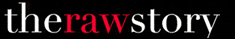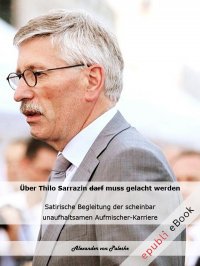Pannenreaktor
Am 4. Mai 1986 kam es zu einem der größten atomaren Störfälle in Deutschland – noch immer sollen die Folgen vertuscht werden.
Michael Schulze von Glaßer - „Wir wurden für einen hochgefährlichen Reaktortest als Versuchskaninchen missbraucht“, empört sich Horst Blume. Der 54-Jährige hat eine Unterschriftensammlung in der Region Lippetal/Hamm organisiert, um die Bundesregierung zur Erstellung einer Leukämiestudie zu bewegen. Bei der Bürgerinitiative Umweltschutz Hamm, in der Blume seit 1976 aktiv ist, sind in den letzten Jahren zahlreiche Meldungen von Bürgern über Krebsfälle in der Region eingegangen. Schuld ist der Thorium-Hochtemperaturreaktor in Hamm-Uentrop, ist sich Blume sicher.

Erst durch Messungen wurde bekannt, dass die erhöhte Radioaktivität nicht nur von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl her rührte, sondern auch aus dem THTR-Hamm stammte.
Der Prototyp für Hochtemperaturreaktoren wurde 1984 nach langwieriger 13-Jähriger Bauzeit im östlichen Teil der Ruhrgebietsstadt Hamm fertig gestellt. Der Reaktor mit 300-Megawatt Leistung ging aber erst zwei Jahre später ans Netz. Als alle Welt nach Tschernobyl blickte geschah am 4. Mai 1986 ein schwerwiegender Unfall im Hammer-Reaktor. Im THTR klemmten gleich mehrere Kugelbrennelemente im Rohrsystem des Atomreaktors.
Die 6cm-Durchmesser umfassenden Brennelementekugeln zerbarsten und wurden schließlich mit hohem Druck in die Umwelt geblasen. Die Messanlagen waren zu diesem Zeitpunkt aufgrund von Wartungsarbeiten abgeschaltet. Anstatt den schweren Vorfall zu melden, versuchte die Betreiberfirma VEW (heute RWE) ihn zu verschweigen. Erst durch Messungen von Umweltschützern – darunter Greenpeace und das Ökoinstitut - wurde bekannt, dass die erhöhte Radioaktivität im Ruhrgebiet nicht nur von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl her rührte, sondern auch aus dem THTR-Hamm stammte.
Diese und weitere Pannen sowie allgemeine Sicherheitsbedenken führten schon 1989 – nach nur 423 Volllast-Betriebstagen – zur Abschaltung des Hochtemperaturreaktors. 1991 wurde der 180 Meter hohe Kühlturm gesprengt. Von 1993 bis 1995 wurden die restlichen Brennelemente ins unweit entfernte atomare Zwischenlager Ahaus gebracht. Zwei Jahre später – 1997 – wurde der Pannenreaktor eingemottet, was jedoch weiterhin zu erheblichen Kosten führt. Der stillgelegte Reaktor kostet den Steuerzahler jährlich etwa 5,6 Millionen Euro – der heute für den Reaktor verantwortliche Energiekonzern RWE gibt nur ein paar Hunderttausend Euro im Jahr für den Stilllegungsbetrieb dazu.
Der Rückbau wird nach optimistischen Schätzungen fast eine Milliarde Euro kosten. Noch muss die Radioaktivität im kurzlebigen Reaktor allerdings abklingen – frühestens 2027 kann der Meiler und somit auch die rund 390 Tonnen verstrahlten Bauteile abgerissen werden. Auch 1,6 Kilogramm Plutonium müssen dann entsorgt werden.
Die 4.000 gesammelten Unterschriften übergab Horst Blume gemeinsam mit weiteren Atomkraftgegnern im Juli 2008 einem Sprecher des Bundesumweltministeriums in Berlin.
Anschließend diskutierten die Atomkraftgegner über eine Stunde lang mit Sprechern des Umweltministeriums und des Ministeriums für Strahlenschutz. Der Ausgang des Gesprächs war ernüchternd: zwar begrüßten die Ministerien das Engagement der Atomkraftgegner, eine Leukämiestudie rund um den Reaktor werde es dennoch nicht geben - Der THTR sei nur ein Prototyp und kurze Zeit in Betrieb gewesen, argumentierte der Sprecher des Bundesumweltministeriums.
Das sich das Ministerium vor der Erstellung einer solchen Studie sträubt wundert Horst Blume nicht: „Der störanfällige Forschungsreaktor wurde damals massiv von der Regierung gefördert, heute wollen sich diese Leute nicht mehr dafür verantworten“. Zudem handele es sich beim THTR um ein Exportprodukt. Südafrika wollte einen solchen Reaktor mit deutscher Hilfe bauen und dann selbst exportieren. Die fortgeschrittenen Planungen wurden wegen der Finanzkrise vorerst eingestellt.
Eine Krebsstudie rund um den Reaktor – wie sie 2007 schon an allen deutschen Atomkraftwerksstandorten fertig gestellt wurde - hätte das Exportprojekt ebenfalls zum scheitern bringen können. „Für die Zukunft des Atomexports wurde auf eine zwingend notwendige unabhängige Untersuchung verzichtet“, fasst es Horst Blume zusammen.
Michael Schulze von Glaßer - „Wir wurden für einen hochgefährlichen Reaktortest als Versuchskaninchen missbraucht“, empört sich Horst Blume. Der 54-Jährige hat eine Unterschriftensammlung in der Region Lippetal/Hamm organisiert, um die Bundesregierung zur Erstellung einer Leukämiestudie zu bewegen. Bei der Bürgerinitiative Umweltschutz Hamm, in der Blume seit 1976 aktiv ist, sind in den letzten Jahren zahlreiche Meldungen von Bürgern über Krebsfälle in der Region eingegangen. Schuld ist der Thorium-Hochtemperaturreaktor in Hamm-Uentrop, ist sich Blume sicher.

Erst durch Messungen wurde bekannt, dass die erhöhte Radioaktivität nicht nur von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl her rührte, sondern auch aus dem THTR-Hamm stammte.
Der Prototyp für Hochtemperaturreaktoren wurde 1984 nach langwieriger 13-Jähriger Bauzeit im östlichen Teil der Ruhrgebietsstadt Hamm fertig gestellt. Der Reaktor mit 300-Megawatt Leistung ging aber erst zwei Jahre später ans Netz. Als alle Welt nach Tschernobyl blickte geschah am 4. Mai 1986 ein schwerwiegender Unfall im Hammer-Reaktor. Im THTR klemmten gleich mehrere Kugelbrennelemente im Rohrsystem des Atomreaktors.
Die 6cm-Durchmesser umfassenden Brennelementekugeln zerbarsten und wurden schließlich mit hohem Druck in die Umwelt geblasen. Die Messanlagen waren zu diesem Zeitpunkt aufgrund von Wartungsarbeiten abgeschaltet. Anstatt den schweren Vorfall zu melden, versuchte die Betreiberfirma VEW (heute RWE) ihn zu verschweigen. Erst durch Messungen von Umweltschützern – darunter Greenpeace und das Ökoinstitut - wurde bekannt, dass die erhöhte Radioaktivität im Ruhrgebiet nicht nur von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl her rührte, sondern auch aus dem THTR-Hamm stammte.
Diese und weitere Pannen sowie allgemeine Sicherheitsbedenken führten schon 1989 – nach nur 423 Volllast-Betriebstagen – zur Abschaltung des Hochtemperaturreaktors. 1991 wurde der 180 Meter hohe Kühlturm gesprengt. Von 1993 bis 1995 wurden die restlichen Brennelemente ins unweit entfernte atomare Zwischenlager Ahaus gebracht. Zwei Jahre später – 1997 – wurde der Pannenreaktor eingemottet, was jedoch weiterhin zu erheblichen Kosten führt. Der stillgelegte Reaktor kostet den Steuerzahler jährlich etwa 5,6 Millionen Euro – der heute für den Reaktor verantwortliche Energiekonzern RWE gibt nur ein paar Hunderttausend Euro im Jahr für den Stilllegungsbetrieb dazu.
Der Rückbau wird nach optimistischen Schätzungen fast eine Milliarde Euro kosten. Noch muss die Radioaktivität im kurzlebigen Reaktor allerdings abklingen – frühestens 2027 kann der Meiler und somit auch die rund 390 Tonnen verstrahlten Bauteile abgerissen werden. Auch 1,6 Kilogramm Plutonium müssen dann entsorgt werden.
Die 4.000 gesammelten Unterschriften übergab Horst Blume gemeinsam mit weiteren Atomkraftgegnern im Juli 2008 einem Sprecher des Bundesumweltministeriums in Berlin.
Anschließend diskutierten die Atomkraftgegner über eine Stunde lang mit Sprechern des Umweltministeriums und des Ministeriums für Strahlenschutz. Der Ausgang des Gesprächs war ernüchternd: zwar begrüßten die Ministerien das Engagement der Atomkraftgegner, eine Leukämiestudie rund um den Reaktor werde es dennoch nicht geben - Der THTR sei nur ein Prototyp und kurze Zeit in Betrieb gewesen, argumentierte der Sprecher des Bundesumweltministeriums.
Das sich das Ministerium vor der Erstellung einer solchen Studie sträubt wundert Horst Blume nicht: „Der störanfällige Forschungsreaktor wurde damals massiv von der Regierung gefördert, heute wollen sich diese Leute nicht mehr dafür verantworten“. Zudem handele es sich beim THTR um ein Exportprodukt. Südafrika wollte einen solchen Reaktor mit deutscher Hilfe bauen und dann selbst exportieren. Die fortgeschrittenen Planungen wurden wegen der Finanzkrise vorerst eingestellt.
Eine Krebsstudie rund um den Reaktor – wie sie 2007 schon an allen deutschen Atomkraftwerksstandorten fertig gestellt wurde - hätte das Exportprojekt ebenfalls zum scheitern bringen können. „Für die Zukunft des Atomexports wurde auf eine zwingend notwendige unabhängige Untersuchung verzichtet“, fasst es Horst Blume zusammen.
sfux - 3. Mai, 16:14 Article 3252x read