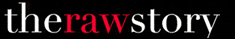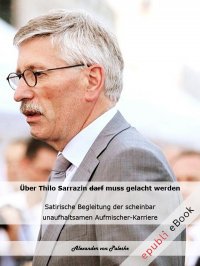Es ist was faul im Staate Universitätsklinik
Dr. Alexander von Paleske ---- 15.6. 2016 ------ Es war der Süddeutschen Zeitung und ihr folgend der ZEIT eine investigative Reportage wert: der Chef der Münchner Universitäts-Kinderklinik, des v.Haunerschen Kinderhospitals, Professor Christoph Klein, hatte Kinder, die an der sehr seltenen Wiskott-Aldrich Erkrankung litten, einer Gentherapie unterzogen - und zwar fast alle.

Artikel in der ZEIT
v. Haunersches Kinderhospital
Nur im Anfang vielversprechend
Das lief in der Anfangszeit gut, aber dann entwickelten die meisten Patienten eine akute Leukämie, einige starben.
Die Komplikationen waren eindeutig auf die Gentherapie zurückzuführen, die Studie wurde gestoppt.
Eine bis dato etablierte Therapie dieser Erkrankung war nicht etwa nicht vorhanden, sondern das war die Stammzelltransplantation.
Die Gentherapie war eine neue Therapie, bisher an dieser Patientengruppe nicht erprobt, und musste insoweit als experimentell angesehen werden. Eine wirkliche Langzeitbeobachtung des allerersten Falles bzw. der allerersten Fälle, bevor dann weitere Patienten behandelt wurden welche die Komplikationen aufgedeckt hätten, gab es ebenfalls nicht.
Nunmehr fragen die Medien, ob hier ein neuer Medizinskandal vorliegt.
Kein Mangel an Skandalen
Über einen Mangel an Medizinskandalen braucht sich in Deutschland niemand zu beklagen. Ganz vorne die Universitätsklinik Freiburg /Breisgau: Skandale in der Hämatologie/ Onkologie , der Unfallchirurgie und der Sportmedizin - wir berichteten ausführlich darüber - und nicht zu vergessen: die Skandale um Manipulationen mit Transplantations-Wartelisten an mehreren Universitätskliniken.
Nun also die Vorfälle in der Universitäts-Kinderklinik München.
Die Studie der Gentherapie an Patienten mit der Wiskott-Aldrich-Erkrankung reicht weiter zurück, als nämlich der bisherige Stelleninhaber noch Oberarzt in der Universitäts-Kinderklinik Hannover war, mit seinem Forschungsschwerpunkt „Gentherapie des Wiskott-Aldrich -Syndroms“
Die Krankheit
Worum handelt es sich bei dieser Erkrankung?
Es handelt sich um einen angeborenen Immundefekt, der ausserdem zu Ekzem, und Verminderung der Blutplättchen (Thrombozytopenie) führt.
Die Folge sind Blutungen und rezidivierende Infektionen.
Der Gendefekt liegt auf dem X-Chromosom. Die Häufigkeit bei männlichen Lebendgeborenen beträgt etwa 1:100.000 bis 1:250.000. Die Lebenserwartung beträgt unbehandelt im Allgemeinen nicht mehr als zehn Jahre.
Bei dieser Erkrankung wird das Wiskott-Aldrich-Protein nicht richtig exprimiert. Das Protein wird für die Organisation des Zytoskeletts benötigt.
Fehlt das Protein in den hämopoetischen Stammzellen, sind T- und B-Lymphozyten, Makrophagen, dendritische Zellen, NK-Zellen und Thrombozyten nicht voll funktionsfähig.
Bereits kurz nach der Geburt treten treten als Folge der Thrombozytopenie teilweise lebensgefährliche Blutungen auf: Sowohl im Magen Darmtrakt als auch im Gehirn. Ein Ekzem entwickelt sich ebenfalls kurz nach der Geburt.
Die Immunität wird fortlaufend geringer, die Infektneigung steigt dementsprechend stark an, und erreicht bereits im zweiten Lebensjahr einen Höhepunkt.
Bösartige Erkrankungen des Lymphatischen Systems kommen gehäuft vor, allerdings keine Leukämien.
Durch die bereits erwähnte Stammzelltransplantation, die ihre eigenen Risiken hat, kann die Wiederherstellung eines funktionsfähigen Immunsystems erreicht werden.
Gentherapie führte in die Sackgasse
Hier setzt nun die Gentherapie an, welche die funktionslosen Genabschnitte ersetzen soll.
Derartige Genabschnitte aus gesunden Zellen herausauszuschneiden, ist heute kein Riesenproblem mehr.
Allerdings ist es nach wie vor ein Riesenproblem, die Genabschnitte exakt dort einzusetzen, wo sie hingehören.
Da geht es eher zu wie bei der Flaschenpost: man hofft, dass sie an der richtigen Stelle ankommen.
Als Transport-Vehikel werden oftmals Viren eingesetzt, welche in die Empfängerzelle eindringen, im Huckepack die gesunden Genabschnitte.
Es kommt für die Wieder-Herstellung der Funktion oftmals nicht darauf an, dass der einzufügende Genabschnitt an der vorgesehenen Stelle ankommt, um Funktionsfähigkeit zu erzeugen. So war das wohl auch bei der Gentherapie des Wiskott-Aldrich Syndroms.
Allerdings sind die Chromosomen nun nicht irgendein beliebiger geeigneter Abladeplatz, sondern fein austariert. Und wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, dann kann es zur Offenlegung von Onkogenen kommen, die wiederum die Krebsbildung ermöglichen.
So war es offenbar auch hier.
Im Detail
Eine erste klinische Studie wurde bereits im Jahr 2006 an der Medizinischen Hochschule Hannover initiiert. Erste Resultate zeigten, dass mit der hämopoetischen Stammzell-Gentherapie durch retroviral modifizierte Stammzellen eine Rekonstitution des Immunsystems bei Wiskott-Aldrich Patienten erreicht werden kann.
Die so behandelten Kinder zeigten im zeitlichen Verlauf eine deutliche Verbesserung ihrer Symptome oder waren beschwerdefrei (keine Blutungszeichen, weniger Infekte, keine Ekzeme).
Die erreichten Heilungserfolge stellten sich nach mehreren Wochen und Monaten ein, und waren nachhaltig über einen langen Zeitraum (in der Regel mehrere Jahre) zu beobachten. Allerdings kam dann der Hammer:
Professor Christoph Klein und seine Arbeitsgruppe berichteten dass inzwischen 7 von 9 Patienten, bei denen die Gentherapie erfolgreich war, eine akute Leukämie bzw. eine Vorstufe dazu, ein myelodysplastisches Syndrom entwickelt haben. Ein katastrophaler Ausgang, der eindeutig der Gentherapie zuzuschreiben ist.
Zur Behandlung der Leukämie war eine aggressive Chemotherapie erforderlich, nicht ohne Risiken, gefolgt von einer Fremdspender-Knochenmark-Transplantation, ebenfalls nicht ohne Risiken, entsprechend hoch die Todesrate.
Verantwortlich oder unverantwortlich?
Die Frage stellt sich: handelt es sich um die unverantwortliche Forschung eines karrieregeilen Mediziners, oder um einen gerechtfertigten medizinischen Fortschrittsversuch, der leider nicht die gewünschten Ergebnisse erbracht hat oder um eine Kombination von beidem.
Die Gentherapie ist vielfach versucht worden, z.B. bei Blutern, mit bis heute (noch) nicht befriedigenden Ergebnissen, möglicherweise ist sie letztlich noch nicht ausgereift, time will tell.
Von unverantwortlicher Forschung kann somit keine Rede sein. Das heisst noch lange nicht, dass hier keine Kritik nötig wäre.
Kritik am Platze
Es wäre wohl besser gewesen, zunächst einmal nur sehr sehr wenige ausgewählte Patienten zu behandeln und dann abzuwarten, ob längerfristig mit Nebenwirkungen, insbesondere schweren Komplikationen zu rechnen ist.
Abwarten heisst aber auch_ weniger Patienten in einer Publikation vorstellen zu können. Und Publikationen sind alles in der Karriere.
Merksatz: publish or perish - Publiziere oder gehe unter.
Mindestens 150 in angesehenen Medizinzeitschriften untergebrachte Publikationen sollen es schon sein, um sich um einen Lehrstuhl mit Aussicht auf Erfolg bewerben zu können.
Der Zeitdruck ist enorm. Nach dem 45. Lebensjahr sind Erst-Berufungen auf Lehrstühle – Endziel einer Universitätskarriere - so gut wie ausgeschlossen. Am besten 40 oder sogar Ende 30. Ein gnadenloser Kampf, der sich vermeiden liesse, wenn es an den Unikliniken ein besseres Kollegialsystem und längerfristige Perspektiven auch für Nicht-Lehrstuhlinhaber gäbe: Flache Hierarchien. Lebenszeitstellungen bei Forschungs-Schwerpunkten. Dann wäre auch der enorme Zeitdruck weg.
So hatte es der Studienleiter Klein geschafft, in der hoch angesehenen Medizinzeitung, dem New England Journal of Medicine, seine (vorläufigen) Ergebnisse zu publizieren. Damit war er nahezu unschlagbar für höhere Weihen qualifiziert. Die behandelten Kinder hatten hingegen das Nachsehen.
Dabei sagen derartige Forschungen und Publikationen der Forschungsergebnisse eigentlich noch nichts darüber aus, ob jemand als Direktor einer Kinderklinik,, die ja alle Bereiche der Kinderheilkunde umfasst, qualifiziert ist.
Tabula rasa nach der Berufung
Mehr noch: wenn derartige Neuberufungen kommen, dann müssen vom alten Stamm einige -nicht gerade die schlechtesten oftmals gehen. Entweder freiwillig oder rausgedrängt.
Abschreckendes Beispiel:
Eine Uniklinik in einer deutschen Großstadt, wo ein hochkompetenter, und auch menschlich hervorragender Hämatologe, mit dem Schwerpunkt Knochenmarktransplantation, der bahnbrechende Forschungsergebnisse in der Behandlung des Rezidivs der Leukämie aufweisen konnte, schliesslich seinen Hut nahm, als ein neuer Direktor und Lehrstuhlinhaber berufen wurde.
Ebenso ging ein hervorragender Hämatologe in derselben Klinik mit Schwerpunkt der Leukämiediagnostik, der nunmehr ein Riesen-Labor gegenüber seiner alten Klinik betreibt, international hoch angesehen und eine Art nationales Referenzlabor.
Ironie der Geschichte: Selbst die Uniklinik schickt mittlerweile Proben zur Begutachtung dorthin.
Solche Leute hält man, möchte man meinen. Am besten durch selbständige Bereiche in die auch der Direktor nicht reinreden kann, flache Hierarchien eben.
Und so sind die Ereignisse im Zusammenhang mit der Gentherapie des Wiskott-Aldrich Syndroms auch Ausdruck einer fehlgeleiteten Organisierung des Universitäts-Krankenhausbetriebes.
Wer sich an dem Fall des Professor Klein festkrallt, übersieht, woran das ganze System krankt.
 Aussitzen, Ausschwitzen, kein Drang zur Aufklärung: die Skandal-Uniklinik Freiburg/Breisgau
Aussitzen, Ausschwitzen, kein Drang zur Aufklärung: die Skandal-Uniklinik Freiburg/Breisgau
 Sinkende Bereitschaft zur Organspende und Vertrauensverlust: Die Folgen der Ärzteskandale in Deutschland
Sinkende Bereitschaft zur Organspende und Vertrauensverlust: Die Folgen der Ärzteskandale in Deutschland

Artikel in der ZEIT
v. Haunersches Kinderhospital
Nur im Anfang vielversprechend
Das lief in der Anfangszeit gut, aber dann entwickelten die meisten Patienten eine akute Leukämie, einige starben.
Die Komplikationen waren eindeutig auf die Gentherapie zurückzuführen, die Studie wurde gestoppt.
Eine bis dato etablierte Therapie dieser Erkrankung war nicht etwa nicht vorhanden, sondern das war die Stammzelltransplantation.
Die Gentherapie war eine neue Therapie, bisher an dieser Patientengruppe nicht erprobt, und musste insoweit als experimentell angesehen werden. Eine wirkliche Langzeitbeobachtung des allerersten Falles bzw. der allerersten Fälle, bevor dann weitere Patienten behandelt wurden welche die Komplikationen aufgedeckt hätten, gab es ebenfalls nicht.
Nunmehr fragen die Medien, ob hier ein neuer Medizinskandal vorliegt.
Kein Mangel an Skandalen
Über einen Mangel an Medizinskandalen braucht sich in Deutschland niemand zu beklagen. Ganz vorne die Universitätsklinik Freiburg /Breisgau: Skandale in der Hämatologie/ Onkologie , der Unfallchirurgie und der Sportmedizin - wir berichteten ausführlich darüber - und nicht zu vergessen: die Skandale um Manipulationen mit Transplantations-Wartelisten an mehreren Universitätskliniken.
Nun also die Vorfälle in der Universitäts-Kinderklinik München.
Die Studie der Gentherapie an Patienten mit der Wiskott-Aldrich-Erkrankung reicht weiter zurück, als nämlich der bisherige Stelleninhaber noch Oberarzt in der Universitäts-Kinderklinik Hannover war, mit seinem Forschungsschwerpunkt „Gentherapie des Wiskott-Aldrich -Syndroms“
Die Krankheit
Worum handelt es sich bei dieser Erkrankung?
Es handelt sich um einen angeborenen Immundefekt, der ausserdem zu Ekzem, und Verminderung der Blutplättchen (Thrombozytopenie) führt.
Die Folge sind Blutungen und rezidivierende Infektionen.
Der Gendefekt liegt auf dem X-Chromosom. Die Häufigkeit bei männlichen Lebendgeborenen beträgt etwa 1:100.000 bis 1:250.000. Die Lebenserwartung beträgt unbehandelt im Allgemeinen nicht mehr als zehn Jahre.
Bei dieser Erkrankung wird das Wiskott-Aldrich-Protein nicht richtig exprimiert. Das Protein wird für die Organisation des Zytoskeletts benötigt.
Fehlt das Protein in den hämopoetischen Stammzellen, sind T- und B-Lymphozyten, Makrophagen, dendritische Zellen, NK-Zellen und Thrombozyten nicht voll funktionsfähig.
Bereits kurz nach der Geburt treten treten als Folge der Thrombozytopenie teilweise lebensgefährliche Blutungen auf: Sowohl im Magen Darmtrakt als auch im Gehirn. Ein Ekzem entwickelt sich ebenfalls kurz nach der Geburt.
Die Immunität wird fortlaufend geringer, die Infektneigung steigt dementsprechend stark an, und erreicht bereits im zweiten Lebensjahr einen Höhepunkt.
Bösartige Erkrankungen des Lymphatischen Systems kommen gehäuft vor, allerdings keine Leukämien.
Durch die bereits erwähnte Stammzelltransplantation, die ihre eigenen Risiken hat, kann die Wiederherstellung eines funktionsfähigen Immunsystems erreicht werden.
Gentherapie führte in die Sackgasse
Hier setzt nun die Gentherapie an, welche die funktionslosen Genabschnitte ersetzen soll.
Derartige Genabschnitte aus gesunden Zellen herausauszuschneiden, ist heute kein Riesenproblem mehr.
Allerdings ist es nach wie vor ein Riesenproblem, die Genabschnitte exakt dort einzusetzen, wo sie hingehören.
Da geht es eher zu wie bei der Flaschenpost: man hofft, dass sie an der richtigen Stelle ankommen.
Als Transport-Vehikel werden oftmals Viren eingesetzt, welche in die Empfängerzelle eindringen, im Huckepack die gesunden Genabschnitte.
Es kommt für die Wieder-Herstellung der Funktion oftmals nicht darauf an, dass der einzufügende Genabschnitt an der vorgesehenen Stelle ankommt, um Funktionsfähigkeit zu erzeugen. So war das wohl auch bei der Gentherapie des Wiskott-Aldrich Syndroms.
Allerdings sind die Chromosomen nun nicht irgendein beliebiger geeigneter Abladeplatz, sondern fein austariert. Und wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, dann kann es zur Offenlegung von Onkogenen kommen, die wiederum die Krebsbildung ermöglichen.
So war es offenbar auch hier.
Im Detail
Eine erste klinische Studie wurde bereits im Jahr 2006 an der Medizinischen Hochschule Hannover initiiert. Erste Resultate zeigten, dass mit der hämopoetischen Stammzell-Gentherapie durch retroviral modifizierte Stammzellen eine Rekonstitution des Immunsystems bei Wiskott-Aldrich Patienten erreicht werden kann.
Die so behandelten Kinder zeigten im zeitlichen Verlauf eine deutliche Verbesserung ihrer Symptome oder waren beschwerdefrei (keine Blutungszeichen, weniger Infekte, keine Ekzeme).
Die erreichten Heilungserfolge stellten sich nach mehreren Wochen und Monaten ein, und waren nachhaltig über einen langen Zeitraum (in der Regel mehrere Jahre) zu beobachten. Allerdings kam dann der Hammer:
Professor Christoph Klein und seine Arbeitsgruppe berichteten dass inzwischen 7 von 9 Patienten, bei denen die Gentherapie erfolgreich war, eine akute Leukämie bzw. eine Vorstufe dazu, ein myelodysplastisches Syndrom entwickelt haben. Ein katastrophaler Ausgang, der eindeutig der Gentherapie zuzuschreiben ist.
Zur Behandlung der Leukämie war eine aggressive Chemotherapie erforderlich, nicht ohne Risiken, gefolgt von einer Fremdspender-Knochenmark-Transplantation, ebenfalls nicht ohne Risiken, entsprechend hoch die Todesrate.
Verantwortlich oder unverantwortlich?
Die Frage stellt sich: handelt es sich um die unverantwortliche Forschung eines karrieregeilen Mediziners, oder um einen gerechtfertigten medizinischen Fortschrittsversuch, der leider nicht die gewünschten Ergebnisse erbracht hat oder um eine Kombination von beidem.
Die Gentherapie ist vielfach versucht worden, z.B. bei Blutern, mit bis heute (noch) nicht befriedigenden Ergebnissen, möglicherweise ist sie letztlich noch nicht ausgereift, time will tell.
Von unverantwortlicher Forschung kann somit keine Rede sein. Das heisst noch lange nicht, dass hier keine Kritik nötig wäre.
Kritik am Platze
Es wäre wohl besser gewesen, zunächst einmal nur sehr sehr wenige ausgewählte Patienten zu behandeln und dann abzuwarten, ob längerfristig mit Nebenwirkungen, insbesondere schweren Komplikationen zu rechnen ist.
Abwarten heisst aber auch_ weniger Patienten in einer Publikation vorstellen zu können. Und Publikationen sind alles in der Karriere.
Merksatz: publish or perish - Publiziere oder gehe unter.
Mindestens 150 in angesehenen Medizinzeitschriften untergebrachte Publikationen sollen es schon sein, um sich um einen Lehrstuhl mit Aussicht auf Erfolg bewerben zu können.
Der Zeitdruck ist enorm. Nach dem 45. Lebensjahr sind Erst-Berufungen auf Lehrstühle – Endziel einer Universitätskarriere - so gut wie ausgeschlossen. Am besten 40 oder sogar Ende 30. Ein gnadenloser Kampf, der sich vermeiden liesse, wenn es an den Unikliniken ein besseres Kollegialsystem und längerfristige Perspektiven auch für Nicht-Lehrstuhlinhaber gäbe: Flache Hierarchien. Lebenszeitstellungen bei Forschungs-Schwerpunkten. Dann wäre auch der enorme Zeitdruck weg.
So hatte es der Studienleiter Klein geschafft, in der hoch angesehenen Medizinzeitung, dem New England Journal of Medicine, seine (vorläufigen) Ergebnisse zu publizieren. Damit war er nahezu unschlagbar für höhere Weihen qualifiziert. Die behandelten Kinder hatten hingegen das Nachsehen.
Dabei sagen derartige Forschungen und Publikationen der Forschungsergebnisse eigentlich noch nichts darüber aus, ob jemand als Direktor einer Kinderklinik,, die ja alle Bereiche der Kinderheilkunde umfasst, qualifiziert ist.
Tabula rasa nach der Berufung
Mehr noch: wenn derartige Neuberufungen kommen, dann müssen vom alten Stamm einige -nicht gerade die schlechtesten oftmals gehen. Entweder freiwillig oder rausgedrängt.
Abschreckendes Beispiel:
Eine Uniklinik in einer deutschen Großstadt, wo ein hochkompetenter, und auch menschlich hervorragender Hämatologe, mit dem Schwerpunkt Knochenmarktransplantation, der bahnbrechende Forschungsergebnisse in der Behandlung des Rezidivs der Leukämie aufweisen konnte, schliesslich seinen Hut nahm, als ein neuer Direktor und Lehrstuhlinhaber berufen wurde.
Ebenso ging ein hervorragender Hämatologe in derselben Klinik mit Schwerpunkt der Leukämiediagnostik, der nunmehr ein Riesen-Labor gegenüber seiner alten Klinik betreibt, international hoch angesehen und eine Art nationales Referenzlabor.
Ironie der Geschichte: Selbst die Uniklinik schickt mittlerweile Proben zur Begutachtung dorthin.
Solche Leute hält man, möchte man meinen. Am besten durch selbständige Bereiche in die auch der Direktor nicht reinreden kann, flache Hierarchien eben.
Und so sind die Ereignisse im Zusammenhang mit der Gentherapie des Wiskott-Aldrich Syndroms auch Ausdruck einer fehlgeleiteten Organisierung des Universitäts-Krankenhausbetriebes.
Wer sich an dem Fall des Professor Klein festkrallt, übersieht, woran das ganze System krankt.
onlinedienst - 15. Jun, 20:25 Article 2614x read