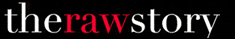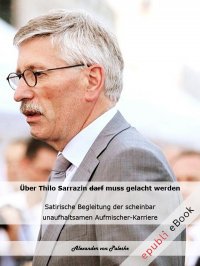Kommunen lassen das Zocken nicht – zum Nachteil der Bürger: Diesmal mit der Greensill-Bank
Dr. Alexander von Paleske ——- 7.3. 2021 ———-
Den Städten und Gemeinden geht es finanziell schlecht: Zunehmenden Aufgaben stehen sinkende Einnahmen gegenüber. Einnahmen, die sich dank der Corona-Krise auch noch drastisch im Rückgang befinden, insbesondere die Gewerbesteuer. Ausserdem drückten in den Nuller-Jahren und davor die hohen Kreditzinsen. Das Wasser stand und steht vielen von ihnen bis zum Hals allerdings schon lange vor Coronakrise und Flüchtlingswelle.
Immer mehr Lasten
Immer mehr Lasten wurden den Kommunen aufgebürdet
Gerade auch die Unvorhersehbarkeit der Zinsentwicklung machten eine vernünftige Zukunftsplanung unmöglich:
Griff nach dem Strohhalm
In einer so verzweifelten Lage griffen Gemeinden und Gemeindebetriebe dankbar zu, als sich Banken als scheinbare Retter in der Not anboten: Zunächst mit Zinsswaps.
Keine Wohltäter
Banken sind keine Wohltäter, sondern wollen Geschäfte machen. Die Gemeinden hingegen wollten ihre Schuldenlast verringern, zumindest die Zinslast der laufenden Kredite. Auf jeden Fall aber über Jahre nicht von den Zins-Schwankungen auf dem Kapitalmarkt abhängig sein.
Da boten die Banken einen scheinbar idealen Ausweg an, und in der Lage, in der sich die Kommunen war selbst der Griff zum Strohhalm vielversprechend, und blindes Vertrauen die Geschäftsgrundlage. Das sollte sich bitter rächen.
Wettgeschäfte mit Banken
Die Banken tauschten mit den Gemeinden die Zinslast. Die Gemeinden zahlten von nun an einen festen Zinssatz, unabhängig von jeglichen Schwankungen, die Banken hingegen zahlten die Differenz, wenn der Marktzinssatz über dem vereinbarten Zinssatz lag, die Gemeinde hingegen an die Bank weit mehr, wenn der aktuelle Zinssatz darunter lag, da eine Anpassung ausgeschlossen war, sie blieb auf den höheren Zinsen sitzen.
Eine 50:50 Wette, bei der die Wahrscheinlichkeit, dass die Gemeinden der Gewinner und die Banken der Verlierer sind, bei 50% lag.
Eins Zinswette und damit ein Spekulationsgeschäft, denn wenn der Marktzins sinkt, haben die Gemeinden das Nachsehen. Und genau das spielte sich in den vergangenen mit extrem niedrigen Kapitalmarktzinsen ab.
Klar, dass die Banken nicht wirklich an dieser Risikoverteilung interessiert waren, sondern die Wahrscheinlichkeit des Verlustes deutlich reduzieren wollten, „Optimierung“ auch genannt. Das geschah auf zweierlei Weise:
– durch die Koppelung mit weiteren Spekulationsgeschäften wie Anbindung der Kreditsumme an Fremdwährungen, sog Cross Currency Swaps.
Als Referenzwährung diente dann nicht der Euro, sondern vielfach der Schweizer Franken. Und der steigerte seinen Wert gegenüber dem Euro um satte 30%, mit der Folge, dass sich die Schuldenlast der Gemeinden weiter steigerte. die Gemeinden schliesslich weit, weit mehr zu zahlen hatten, als das was ursprünglich an Zinsen angefallen wäre
– durch Verkoppelung an weitere spekulative Entwicklungen und Geschäfte, sodass aus dem einfachen Swap ein kompliziertes komplexes Etwas wurde, bei dem nur noch gewiefte Volkswirte den Durchblick behielten – wenn überhaupt.
Die Banken wiederum sicherten sich durch gegenläufige Geschäfte ab, hedgen auch genannt.
Mit andere Worten aus einem 50 : 50 Risikogeschäft wurde das Risiko der Banken vermindert, das Risiko der Gemeinden ,jedoch drastisch erhöht.
Teure Blindheit
Nachdem die Gemeinden recht unsanft aus ihrem Schlaf erwachten, standen sie nun vor Riesenverlusten. So z.B. die Stadt Hagen mit schlappen 50 Millionen Euro, eine Stadt, die nicht gerade mit einem hohen Steueraufkommen gesegnet ist. Nicht wesentlich besser ging es der Stadt Neuss. Die Liste der so geschädigten Kommunen ist schier endlos.
Pacta sunt servanda – Verträge müssen eingehalten werden, das sagten die Banken, allen voran die Deutsche Bank, das sagten oft auch die Untergerichte, die entscheiden sollten, ob die Gemeinden über den Tisch gezogen worden waren, und deshalb einen Anspruch auf Rückabwicklung hätten, oder nicht.
Nicht wenige Kommunen scheuten das Prozessrisiko und schlossen Vergleiche, die den Banken immerhin einen guten Teil ihrer Gewinne sicherten und die Kommunen lediglich mit einer Begrenzung der Verluste davonkommen liess.
BGH zieht Reissleine
Einige wenige, wie die Kommune Hückeswagen, zogen das Verfahren bis zum Bundesgerichtshof (BGH), der daraufhin jetzt die Reissleine zog, diesen Geschäften die rote Karte zeigte und klare Regeln aufstellte, sollten die Verträge Gnade vor den Gerichten finden.
Mittlerweile swapsen die Gemeinden nicht mehr. Das teure Lehrgeld aber bezahlten weder die Gemeindevertreter, noch die Banker, sondern die Bürger, die mit Leistungseinschränkungen wie Schwimmbad-Schliessungen, Erhöhungen des Wassergeldes etc. rechnen mussten.
Nichts gelernt
Nun sind wieder eine Reihe von Gemeinden und Städten Risikogeschäfte eingegangen: Diesmal mit einer scheinbar seriösen Bank, die weit höhere Zinsen, als den marktüblichen Zins, der nahe Null liegt, anboten.
15.000 private Anleger, viele institutionelle Anleger, und mehr als 50 Kommunen griffen zu und brachten ihr Geld zur Greensill-Bank: z.B. Monheim am Rhein 38 Milliinen Euro,Osnabrück 14 Millionen, Emmerich am Rhein 6 Millionen.
Innerhalb von kurzer Zeit sammelte diese Bank Milliarden bei Sparern, Investoren und Kommunen ein.
Wer so hohe Zinsen anbietet wie die Greensill Bank, der kann dies nicht aus dem normalen banküblichen Geschäftsbetrieb erwirtschaften: also durch Sparergeld, das anschliessend verliehen wird an kreditwürdige Kunden, dafür sind die ueblichen Kreditzinsen einfach viel zu niedrig.
Daher gibt es nur wenige Wege, einen derartigen Zinssatz “stemmen” zu können:
- Weit höhere Zinsen bei der Vergabe von Krediten verlangen, das geht allerdings nur mit Kunden, die woanders keine Kredite mehr bekommen, und damit ein sehr hohes Ausfallrisiko haben.
- Durch Geschäfte anderer Art: bei der Greensill waren es Zwischen- bzw. Vorfinanzierungen bei Lieferkettengeschäften.
- Durch Zahlung der hohen Zinsen aus den neuen Einlagen, also der typische Fall eines Pyramidenschemas (Schneeballsystem).
Bei der Greensill Bank waren es offenbar Kombinationen, und hinzu soll noch Bilanzfälschung gekommen sein. Also ein neuer “Wirecard-Skandal”.
Schluss aus
Letzte Woche machte die BaFin die Bank zu. Die privaten Sparer koennen durch den Einlagen- Sicherungsfond entschädigt werden: bis zu einem Betrag von 1000.000 Euro. Das gilt jedoch nicht für die Kommunen, die dürften leer ausgehen.
Den Verantwortlichen in den Kommunen hätten sofort Bedenken kommen müssen, woher denn ein derart hoher Sparzins sich finanzieren lässt. Aber nein: stattdessen blindes Vertrauen.
Wieder einmal wurden Steuergelder leichtfertig verzockt, offenbar hat man aus der Swaps-Krise nichts gelernt. Die Bürger der betroffenen Kommunen werden es alsbald zu spüren bekommen.
.
Den Städten und Gemeinden geht es finanziell schlecht: Zunehmenden Aufgaben stehen sinkende Einnahmen gegenüber. Einnahmen, die sich dank der Corona-Krise auch noch drastisch im Rückgang befinden, insbesondere die Gewerbesteuer. Ausserdem drückten in den Nuller-Jahren und davor die hohen Kreditzinsen. Das Wasser stand und steht vielen von ihnen bis zum Hals allerdings schon lange vor Coronakrise und Flüchtlingswelle.
Immer mehr Lasten
Immer mehr Lasten wurden den Kommunen aufgebürdet
Gerade auch die Unvorhersehbarkeit der Zinsentwicklung machten eine vernünftige Zukunftsplanung unmöglich:
Griff nach dem Strohhalm
In einer so verzweifelten Lage griffen Gemeinden und Gemeindebetriebe dankbar zu, als sich Banken als scheinbare Retter in der Not anboten: Zunächst mit Zinsswaps.
Keine Wohltäter
Banken sind keine Wohltäter, sondern wollen Geschäfte machen. Die Gemeinden hingegen wollten ihre Schuldenlast verringern, zumindest die Zinslast der laufenden Kredite. Auf jeden Fall aber über Jahre nicht von den Zins-Schwankungen auf dem Kapitalmarkt abhängig sein.
Da boten die Banken einen scheinbar idealen Ausweg an, und in der Lage, in der sich die Kommunen war selbst der Griff zum Strohhalm vielversprechend, und blindes Vertrauen die Geschäftsgrundlage. Das sollte sich bitter rächen.
Wettgeschäfte mit Banken
Die Banken tauschten mit den Gemeinden die Zinslast. Die Gemeinden zahlten von nun an einen festen Zinssatz, unabhängig von jeglichen Schwankungen, die Banken hingegen zahlten die Differenz, wenn der Marktzinssatz über dem vereinbarten Zinssatz lag, die Gemeinde hingegen an die Bank weit mehr, wenn der aktuelle Zinssatz darunter lag, da eine Anpassung ausgeschlossen war, sie blieb auf den höheren Zinsen sitzen.
Eine 50:50 Wette, bei der die Wahrscheinlichkeit, dass die Gemeinden der Gewinner und die Banken der Verlierer sind, bei 50% lag.
Eins Zinswette und damit ein Spekulationsgeschäft, denn wenn der Marktzins sinkt, haben die Gemeinden das Nachsehen. Und genau das spielte sich in den vergangenen mit extrem niedrigen Kapitalmarktzinsen ab.
Klar, dass die Banken nicht wirklich an dieser Risikoverteilung interessiert waren, sondern die Wahrscheinlichkeit des Verlustes deutlich reduzieren wollten, „Optimierung“ auch genannt. Das geschah auf zweierlei Weise:
– durch die Koppelung mit weiteren Spekulationsgeschäften wie Anbindung der Kreditsumme an Fremdwährungen, sog Cross Currency Swaps.
Als Referenzwährung diente dann nicht der Euro, sondern vielfach der Schweizer Franken. Und der steigerte seinen Wert gegenüber dem Euro um satte 30%, mit der Folge, dass sich die Schuldenlast der Gemeinden weiter steigerte. die Gemeinden schliesslich weit, weit mehr zu zahlen hatten, als das was ursprünglich an Zinsen angefallen wäre
– durch Verkoppelung an weitere spekulative Entwicklungen und Geschäfte, sodass aus dem einfachen Swap ein kompliziertes komplexes Etwas wurde, bei dem nur noch gewiefte Volkswirte den Durchblick behielten – wenn überhaupt.
Die Banken wiederum sicherten sich durch gegenläufige Geschäfte ab, hedgen auch genannt.
Mit andere Worten aus einem 50 : 50 Risikogeschäft wurde das Risiko der Banken vermindert, das Risiko der Gemeinden ,jedoch drastisch erhöht.
Teure Blindheit
Nachdem die Gemeinden recht unsanft aus ihrem Schlaf erwachten, standen sie nun vor Riesenverlusten. So z.B. die Stadt Hagen mit schlappen 50 Millionen Euro, eine Stadt, die nicht gerade mit einem hohen Steueraufkommen gesegnet ist. Nicht wesentlich besser ging es der Stadt Neuss. Die Liste der so geschädigten Kommunen ist schier endlos.
Pacta sunt servanda – Verträge müssen eingehalten werden, das sagten die Banken, allen voran die Deutsche Bank, das sagten oft auch die Untergerichte, die entscheiden sollten, ob die Gemeinden über den Tisch gezogen worden waren, und deshalb einen Anspruch auf Rückabwicklung hätten, oder nicht.
Nicht wenige Kommunen scheuten das Prozessrisiko und schlossen Vergleiche, die den Banken immerhin einen guten Teil ihrer Gewinne sicherten und die Kommunen lediglich mit einer Begrenzung der Verluste davonkommen liess.
BGH zieht Reissleine
Einige wenige, wie die Kommune Hückeswagen, zogen das Verfahren bis zum Bundesgerichtshof (BGH), der daraufhin jetzt die Reissleine zog, diesen Geschäften die rote Karte zeigte und klare Regeln aufstellte, sollten die Verträge Gnade vor den Gerichten finden.
Mittlerweile swapsen die Gemeinden nicht mehr. Das teure Lehrgeld aber bezahlten weder die Gemeindevertreter, noch die Banker, sondern die Bürger, die mit Leistungseinschränkungen wie Schwimmbad-Schliessungen, Erhöhungen des Wassergeldes etc. rechnen mussten.
Nichts gelernt
Nun sind wieder eine Reihe von Gemeinden und Städten Risikogeschäfte eingegangen: Diesmal mit einer scheinbar seriösen Bank, die weit höhere Zinsen, als den marktüblichen Zins, der nahe Null liegt, anboten.
15.000 private Anleger, viele institutionelle Anleger, und mehr als 50 Kommunen griffen zu und brachten ihr Geld zur Greensill-Bank: z.B. Monheim am Rhein 38 Milliinen Euro,Osnabrück 14 Millionen, Emmerich am Rhein 6 Millionen.
Innerhalb von kurzer Zeit sammelte diese Bank Milliarden bei Sparern, Investoren und Kommunen ein.
Wer so hohe Zinsen anbietet wie die Greensill Bank, der kann dies nicht aus dem normalen banküblichen Geschäftsbetrieb erwirtschaften: also durch Sparergeld, das anschliessend verliehen wird an kreditwürdige Kunden, dafür sind die ueblichen Kreditzinsen einfach viel zu niedrig.
Daher gibt es nur wenige Wege, einen derartigen Zinssatz “stemmen” zu können:
- Weit höhere Zinsen bei der Vergabe von Krediten verlangen, das geht allerdings nur mit Kunden, die woanders keine Kredite mehr bekommen, und damit ein sehr hohes Ausfallrisiko haben.
- Durch Geschäfte anderer Art: bei der Greensill waren es Zwischen- bzw. Vorfinanzierungen bei Lieferkettengeschäften.
- Durch Zahlung der hohen Zinsen aus den neuen Einlagen, also der typische Fall eines Pyramidenschemas (Schneeballsystem).
Bei der Greensill Bank waren es offenbar Kombinationen, und hinzu soll noch Bilanzfälschung gekommen sein. Also ein neuer “Wirecard-Skandal”.
Schluss aus
Letzte Woche machte die BaFin die Bank zu. Die privaten Sparer koennen durch den Einlagen- Sicherungsfond entschädigt werden: bis zu einem Betrag von 1000.000 Euro. Das gilt jedoch nicht für die Kommunen, die dürften leer ausgehen.
Den Verantwortlichen in den Kommunen hätten sofort Bedenken kommen müssen, woher denn ein derart hoher Sparzins sich finanzieren lässt. Aber nein: stattdessen blindes Vertrauen.
Wieder einmal wurden Steuergelder leichtfertig verzockt, offenbar hat man aus der Swaps-Krise nichts gelernt. Die Bürger der betroffenen Kommunen werden es alsbald zu spüren bekommen.
.
onlinedienst - 9. Mär, 09:13 Article 676x read