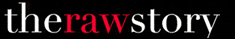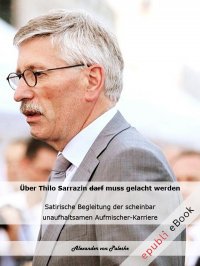Ndrangheta in der Schweiz
Daniele Mariani - Swissinfo - Die kriminellen italienischen Organisationen, namentlich die 'Ndrangheta, sind zuoberst auf der Sorgenliste der Schweizer Regierung. Einige Experten sind jedoch der Ansicht, die Schweiz sei schlecht gerüstet für den Kampf gegen die Mafia.
"Die grösste Gefahr stellt die 'Ndrangheta dar." Das ist das klare Fazit der Schweizer Strategie zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens 2012-2015, welche der Bundesrat Ende März 2012 bekanntgab.
Auch wenn keine schweren Bluttaten wie jene im deutschen Duisburg 2007 (Ermordung von sechs Kalabresen) registriert wurden, sind die 'Ndrine – die Zellen – in der Schweiz bereits gut installiert.
Für die Fachleute ertönt die Alarmglocke der Schweizer Regierung nicht überraschend. Denn seit Jahren betonen Justizbehörden, Polizei und einige Politiker, dass die italienischen Mafia-Organisationen ihre Präsenz in der Schweiz verstärken.
Eine echte physische Präsenz, die sich akzentuiert hat infolge des Drucks auf die Mafia in Italien und durch die "Eroberung" des Nordens, bestätigt durch die kürzlich erfolgte Verhaftungswelle in der Lombardei.
Zahlreiche Beweise und Indizien
Beweise und Indizien für diese Präsenz in der Schweiz sind vorhanden: Im Mai 2011 wurde zum Beispiel ein gefährliches 'Ndrangheta-Mitglied, das ungestört in Frauenfeld, Kanton Thurgau, lebte, in Genua festgenommen.
Wenige Monate zuvor hatte die Antimafia-Behörde von Reggio Calabria am Ende ihrer Operation 'Crimine 2' die internationale Vernetzung der kalabresischen Zellen aufgezeigt, mit wichtigen Ablegern in Deutschland und auch in der Schweiz, besonders in Frauenfeld und in Zürich. "An diesen Orten wurde das Strukturmodell der kalabresischen 'Ndrangheta nachgebildet", schrieb der italienische Ermittlungsrichter.
Die aufgezeichneten Abhöraktionen in den Ermittlungsakten lassen keine Zweifel offen. Zum Beispiel in einem Telefongespräch, das auf einen so genannten "'Ntono dalla Svizzera" anspielt, der den im Juli 2010 in Italien verhafteten Clanchef Giuseppe Antonio Primerano ersucht hat, seine eigene Herrschaft auch in Deutschland und später in der Schweiz ausüben zu können.
Oder als Domenico Oppedisano – der Boss der Bosse, der ebenfalls im Juli 2010 festgenommen wurde – von einer "Bürgschaft von 20 Millionen auf einer Bank in der Schweiz" spricht.
Aus naheliegenden geografischen Gründen erregt die Situation vor allem in den Kantonen Tessin und Wallis Besorgnis, wie Jean-Luc Vez in einem Interview mit der Waadtländer Zeitung 24 heures erklärte. Der Chef der Bundespolizei, verantwortlich für die Untersuchungen gegen kriminelle italienische Organisationen, wollte sich jedoch nicht zu den laufenden Ermittlungen äussern.
Die Schweiz werde von den Mafiosi besonders geschätzt "wegen ihrer Wirtschaft und ihrem Finanzplatz, ebenso wegen ihrer Infrastruktur", sagt die Bundesanwaltschaft.
Die Schweiz sei eine Art logistische Plattform, wo man Geld waschen könne, und zwar nicht nur via Banken und Treuhänder, sondern auch mit Investitionen in Immobilien.
Oder ein Ort, wo man illegalen Handel aufziehen oder Unterschlupf suchen könne: "2010 wurden viele Angehörige von kriminellen italienischen Organisationen, darunter der 'Ndrangheta, in ihr Heimatland ausgeliefert, wo sie bereits zu langen Haftstrafen verurteilt worden sind", heisst es im Jahresbericht der Bundespolizei.
"Einige von ihnen hatten auch in der Schweiz Straftaten begangen, vor allem Drogenhandel. Andere dagegen haben während langer Zeit eine normale Arbeit in der Schweiz ausgeführt, ohne aufzufallen."
Besser spät als nie
Schon vor 25 Jahren hatte der Antimafia-Richter Giovanni Falcone seine Schweizer Amtskollegen davor gewarnt, dass nach den Mafia-Geldern auch die Mafiosi selber ins Land kämen.
Ist man in der Schweiz nicht etwas spät erwacht? Die Bundesanwaltschaft weist darauf hin, dass seit 1994 – mit der Aufnahme ins Strafrecht des Deliktes "Beteiligung oder Unterstützung einer kriminellen Organisation" – die Strafmassnahmen auf Bundesebene koordiniert würden. Und seit 10 Jahren läge die Verfahrenskompetenz bei der Bundesanwaltschaft.
"Besser spät als nie", sagt dazu Nicolas Giannakopoulos, Gründer des Observatoriums für organisierte Kriminalität in Genf. "Endlich hat man sich entschieden, den Stier bei den Hörnern zu packen. Jetzt muss man schauen, wie das Problem angegangen werden kann. Je mehr man zaudert, desto schwieriger wird es, eine Spur zu verfolgen. Das einzige Mittel wäre, viel enger mit den italienischen Behörden zusammenzuarbeiten, denn alles beginnt in Italien und kommt wieder nach Italien zurück."
Ausreichende Mittel?
Ein erster Schritt in diese Richtung war die Ernennung von Bundesanwalt Pierluigi Pasi, der in Lugano residiert, zum Koordinator für Antimafia-Aktionen.
"Wir verfügen über ausreichende Mittel", sagt die Bundesanwaltschaft. Sie betont, dass die Schaffung dieser neuen Funktion "ein konkretes Beispiel" sei, das den Willen zur Optimierung der Ressourcen und zur Koordinierung der Ermittlungen mit den italienischen Untersuchungsbehörden beweise. Eine Zusammenarbeit, die der italienische Antimafia-Generalstaatsanwalt Pietro Grasso in einem Interview mit der Tribune de Genève als "exzellent" bezeichnete.
Oft wird das föderalistische System der Schweiz als wenig geeignet zur Bekämpfung solcher Delikte angesehen. Die präzise Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, die zum Beispiel die Bekämpfung des Drogenhandels den kantonalen Polizeibehörden und die Untersuchungen gegen das organisierte Verbrechen und die Geldwäscherei der Bundespolizei zuweist, sei zweifelsohne ein Hindernis, sagen Experten, die anonym bleiben wollen. Im allgemeinen funktioniere aber die Kooperation, auch wenn alles natürlich von den betroffenen Personen abhänge.
Die Schwierigkeit sei eine andere, so die Fachleute. Die Untersuchungen – an und für sich schon sehr komplex, wenn es um extrem undurchlässige Organisationen wie die 'Ndrangheta gehe – würden noch schwieriger wegen der Einschränkungen bei gewissen Ermittlungsmethoden, wie Abhöraktionen, Beschattungen oder Eindringen in Informatiksysteme. Es nützte nicht viel, wenn diese Methoden erst dann verwendet werden könnten, wenn Beweise vorlägen.
Nach Italien ausrichten
Nicolas Giannakopoulos teilt die Analyse: "Alles ist sehr kompliziert, mit extremen Verfahrensaspekten, wie die jüngsten Fälle zeigen. Wir müssen uns von Italien inspirieren lassen, zum Beispiel was Massnahmen betrifft wie Vermögens- und Güterbeschlagnahmung, die sehr gut funktionieren, oder die Schaffung von dichten Antimafia-Spezialpools. Die Rechtsstruktur der Schweiz ist dazu ungeeignet. Um die Mafia zu bekämpfen, funktionieren Methoden nicht, die gegen Hühnerdiebe angewendet werden."
Eine Beurteilung, die manche sicher zu karikaturartig finden. Die Bundesanwaltschaft ist der Meinung, dass die derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen ausreichende Möglichkeiten garantieren, um das organisierte Verbrechen zu bekämpfen.
Eine Aufgabe, die der im September 2011 nominierte neue Leiter der Bundesanwaltschaft, Michael Lauber, bestens kennt. Er leitete von 1995 bis 2000 die Zentralstelle Organisierte Kriminalität im Bundesamt für Polizei. Ein weiteres Signal dafür, dass die Schweizer Regierung wirklich gewillt ist, das Problem bei den Hörnern zu packen.
"Die grösste Gefahr stellt die 'Ndrangheta dar." Das ist das klare Fazit der Schweizer Strategie zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens 2012-2015, welche der Bundesrat Ende März 2012 bekanntgab.
Auch wenn keine schweren Bluttaten wie jene im deutschen Duisburg 2007 (Ermordung von sechs Kalabresen) registriert wurden, sind die 'Ndrine – die Zellen – in der Schweiz bereits gut installiert.
Für die Fachleute ertönt die Alarmglocke der Schweizer Regierung nicht überraschend. Denn seit Jahren betonen Justizbehörden, Polizei und einige Politiker, dass die italienischen Mafia-Organisationen ihre Präsenz in der Schweiz verstärken.
Eine echte physische Präsenz, die sich akzentuiert hat infolge des Drucks auf die Mafia in Italien und durch die "Eroberung" des Nordens, bestätigt durch die kürzlich erfolgte Verhaftungswelle in der Lombardei.
Zahlreiche Beweise und Indizien
Beweise und Indizien für diese Präsenz in der Schweiz sind vorhanden: Im Mai 2011 wurde zum Beispiel ein gefährliches 'Ndrangheta-Mitglied, das ungestört in Frauenfeld, Kanton Thurgau, lebte, in Genua festgenommen.
Wenige Monate zuvor hatte die Antimafia-Behörde von Reggio Calabria am Ende ihrer Operation 'Crimine 2' die internationale Vernetzung der kalabresischen Zellen aufgezeigt, mit wichtigen Ablegern in Deutschland und auch in der Schweiz, besonders in Frauenfeld und in Zürich. "An diesen Orten wurde das Strukturmodell der kalabresischen 'Ndrangheta nachgebildet", schrieb der italienische Ermittlungsrichter.
Die aufgezeichneten Abhöraktionen in den Ermittlungsakten lassen keine Zweifel offen. Zum Beispiel in einem Telefongespräch, das auf einen so genannten "'Ntono dalla Svizzera" anspielt, der den im Juli 2010 in Italien verhafteten Clanchef Giuseppe Antonio Primerano ersucht hat, seine eigene Herrschaft auch in Deutschland und später in der Schweiz ausüben zu können.
Oder als Domenico Oppedisano – der Boss der Bosse, der ebenfalls im Juli 2010 festgenommen wurde – von einer "Bürgschaft von 20 Millionen auf einer Bank in der Schweiz" spricht.
Aus naheliegenden geografischen Gründen erregt die Situation vor allem in den Kantonen Tessin und Wallis Besorgnis, wie Jean-Luc Vez in einem Interview mit der Waadtländer Zeitung 24 heures erklärte. Der Chef der Bundespolizei, verantwortlich für die Untersuchungen gegen kriminelle italienische Organisationen, wollte sich jedoch nicht zu den laufenden Ermittlungen äussern.
Die Schweiz werde von den Mafiosi besonders geschätzt "wegen ihrer Wirtschaft und ihrem Finanzplatz, ebenso wegen ihrer Infrastruktur", sagt die Bundesanwaltschaft.
Die Schweiz sei eine Art logistische Plattform, wo man Geld waschen könne, und zwar nicht nur via Banken und Treuhänder, sondern auch mit Investitionen in Immobilien.
Oder ein Ort, wo man illegalen Handel aufziehen oder Unterschlupf suchen könne: "2010 wurden viele Angehörige von kriminellen italienischen Organisationen, darunter der 'Ndrangheta, in ihr Heimatland ausgeliefert, wo sie bereits zu langen Haftstrafen verurteilt worden sind", heisst es im Jahresbericht der Bundespolizei.
"Einige von ihnen hatten auch in der Schweiz Straftaten begangen, vor allem Drogenhandel. Andere dagegen haben während langer Zeit eine normale Arbeit in der Schweiz ausgeführt, ohne aufzufallen."
Besser spät als nie
Schon vor 25 Jahren hatte der Antimafia-Richter Giovanni Falcone seine Schweizer Amtskollegen davor gewarnt, dass nach den Mafia-Geldern auch die Mafiosi selber ins Land kämen.
Ist man in der Schweiz nicht etwas spät erwacht? Die Bundesanwaltschaft weist darauf hin, dass seit 1994 – mit der Aufnahme ins Strafrecht des Deliktes "Beteiligung oder Unterstützung einer kriminellen Organisation" – die Strafmassnahmen auf Bundesebene koordiniert würden. Und seit 10 Jahren läge die Verfahrenskompetenz bei der Bundesanwaltschaft.
"Besser spät als nie", sagt dazu Nicolas Giannakopoulos, Gründer des Observatoriums für organisierte Kriminalität in Genf. "Endlich hat man sich entschieden, den Stier bei den Hörnern zu packen. Jetzt muss man schauen, wie das Problem angegangen werden kann. Je mehr man zaudert, desto schwieriger wird es, eine Spur zu verfolgen. Das einzige Mittel wäre, viel enger mit den italienischen Behörden zusammenzuarbeiten, denn alles beginnt in Italien und kommt wieder nach Italien zurück."
Ausreichende Mittel?
Ein erster Schritt in diese Richtung war die Ernennung von Bundesanwalt Pierluigi Pasi, der in Lugano residiert, zum Koordinator für Antimafia-Aktionen.
"Wir verfügen über ausreichende Mittel", sagt die Bundesanwaltschaft. Sie betont, dass die Schaffung dieser neuen Funktion "ein konkretes Beispiel" sei, das den Willen zur Optimierung der Ressourcen und zur Koordinierung der Ermittlungen mit den italienischen Untersuchungsbehörden beweise. Eine Zusammenarbeit, die der italienische Antimafia-Generalstaatsanwalt Pietro Grasso in einem Interview mit der Tribune de Genève als "exzellent" bezeichnete.
Oft wird das föderalistische System der Schweiz als wenig geeignet zur Bekämpfung solcher Delikte angesehen. Die präzise Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, die zum Beispiel die Bekämpfung des Drogenhandels den kantonalen Polizeibehörden und die Untersuchungen gegen das organisierte Verbrechen und die Geldwäscherei der Bundespolizei zuweist, sei zweifelsohne ein Hindernis, sagen Experten, die anonym bleiben wollen. Im allgemeinen funktioniere aber die Kooperation, auch wenn alles natürlich von den betroffenen Personen abhänge.
Die Schwierigkeit sei eine andere, so die Fachleute. Die Untersuchungen – an und für sich schon sehr komplex, wenn es um extrem undurchlässige Organisationen wie die 'Ndrangheta gehe – würden noch schwieriger wegen der Einschränkungen bei gewissen Ermittlungsmethoden, wie Abhöraktionen, Beschattungen oder Eindringen in Informatiksysteme. Es nützte nicht viel, wenn diese Methoden erst dann verwendet werden könnten, wenn Beweise vorlägen.
Nach Italien ausrichten
Nicolas Giannakopoulos teilt die Analyse: "Alles ist sehr kompliziert, mit extremen Verfahrensaspekten, wie die jüngsten Fälle zeigen. Wir müssen uns von Italien inspirieren lassen, zum Beispiel was Massnahmen betrifft wie Vermögens- und Güterbeschlagnahmung, die sehr gut funktionieren, oder die Schaffung von dichten Antimafia-Spezialpools. Die Rechtsstruktur der Schweiz ist dazu ungeeignet. Um die Mafia zu bekämpfen, funktionieren Methoden nicht, die gegen Hühnerdiebe angewendet werden."
Eine Beurteilung, die manche sicher zu karikaturartig finden. Die Bundesanwaltschaft ist der Meinung, dass die derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen ausreichende Möglichkeiten garantieren, um das organisierte Verbrechen zu bekämpfen.
Eine Aufgabe, die der im September 2011 nominierte neue Leiter der Bundesanwaltschaft, Michael Lauber, bestens kennt. Er leitete von 1995 bis 2000 die Zentralstelle Organisierte Kriminalität im Bundesamt für Polizei. Ein weiteres Signal dafür, dass die Schweizer Regierung wirklich gewillt ist, das Problem bei den Hörnern zu packen.
sfux - 26. Mai, 20:52 Article 2105x read