Tod auf Raten – das Ende der Frankfurter Rundschau und anderer Printmedien
Dr. Alexander von Paleske --- 2.12. 2012 ---
Während eines Besuchs in Frankfurt im Juli 2012 fand ich auf Seite 2 und 3 einer Frankfurter Rundschau - das waren einstmals die Politik-Seiten, Seite 3 für politische Hintergrundartikel - einen Riesen-Artikel über „Amseln in der Grosstadt“.
Man brauchte kein Prophet zu sein, um zu konstatieren: das kann nicht gutgehen. Es ging auch nicht gut.
Die Frankfurter Rundschau war zu diesem Zeitpunkt journalistisch bereits kannibalisiert: die überregionalen Nachrichten und Analysen lieferte eine Zentralredaktion in Berlin, welche auch die anderen zum Kölner Verlag duMont-Schauberg gehörenden Blätter (Berliner Zeitung, Kölner Stadtanzeiger, Kölnische Rundschau, Mitteldeutsche Zeitung) journalistisch versorgte.
Jetzt also das vorläufige Ende einer grossen Nachkriegszeitung, linksliberal, ein Blatt, das auch die 68er Studentenbewegung und die Hausbesetzer kritisch, aber im Grundton wohlwollend begleitete. Und für diese Periode steht der Name Karl Gerold, der zusammen mit Arno Rudert (gestorben 1954) in Frankfurt Zeitungsgeschichte schrieb. Mit einem Blatt, das weit über Frankfurt hinaus hohes Ansehen genoss.
Einstmals Lizenz zum Gelddrucken
Drucklizenzen, nach dem Kriege von den Alliierten vergeben, waren de facto wie eine Lizenz zum Gelddrucken, das galt für alle Tageszeitungen, aber auch für Zeitschriften.
Der Hunger nach Informationen brachte die Käufer an die Kioske. Der Wirtschaftsaufschwung mit dem expandierenden Anzeigenmarkt spülte Geld in die Kassen der Verlage.. Und gerade der lokale ausserordentlich lukrative Anzeigenmarkt, den die Frankfurter Rundschau über Jahrzehnte dominierte, war ihre Haupteinnahmequelle.
Damit ist es vorbei. Viele Anzeigen sind mittlerweile ins Internet abgewandert, aber nur zu geringem Teil auf die Online-Auftritte der Tageszeitungen. Die neuesten Nachrichten sind ebenfalls im Internet zu finden, schneller als es die Tageszeitungen vermögen, sodass die Nachrichtenseiten in den Tageszeitungen mehr oder weniger den Schnee von gestern bringen.
Kein zwangsläufiges Ende
Das hätte keineswegs das Ende bedeuten müssen, denn es bleibt nach wie vor der Lokalteil, die tiefschürfenden Hintergrundanalysen, und der investigative Journalismus.
Allerdings braucht es dafür kompetente Journalisten, keine Content-Manager. Die Redaktion der FR wurde jedoch kannibalisiert, sodass zwar investigativ noch etwas ans Tageslicht gezerrt wurde, wie der Skandal um die hessischen Steuerfahnder, aber das alleine reichte nicht mehr.
Neben der Kannibalisierung auch das Fehlen von Konzepten und offenbares Missmanagement .
Auch Auflagen von Zeitschriften fallen
Auch Zeitschriften wie Stern und Brigitte hatten in den vergangenen Jahren deutliche Auflagenrückgänge hinzunehmen. Rückgänge, welche die jeweiligen Verlagen oftmals durch Einrichtung von Zentralredaktionen, also Personalkürzungen, beantworteten. Wir haben uns mehrfach damit beschäftigt.
Parallel dazu fingen Verlage wie Gruner und Jahr an, Firmenzeitschriften zu produzieren, deren Interessen zwangsläufig irgendwann auch mit investigativen journalistischen Recherchen anderer Printmedien kollidieren könnten, kollidieren müssen.
Nicht nur Frankfurter Rundschau
Mit der Nachricht über die Insolvenz der FR dann auch noch die Nachricht über das Ende der vor 12 Jahren gestarteten Financial Times Deutschland (FTD) . Eine Wirtschafts-Tageszeitung, journalistisch deutlich besser als das Handelsblatt, die aber eben keine Gewinne einfuhr sondern Jahr für Jahr Verluste machte. Also weg damit.
Guter Journalismus, der aber keine Gewinne einfährt, hat in einem Verlag wie Gruner und Jahr, der jährlich grosse Gewinne einfährt, mehrheitsmässig zur Betelsmann-Gruppe gehörend, nichts zu suchen.
Das war noch anders zu Zeiten von Gerd Bucerius, einst Mitbegründer des Verlages Gruner und Jahr, der den damaligen Spitzenjournalismus in der ZEIT jahrelang mit Gewinnen aus der Cash-Cow Stern finanzierte.
Nun ist die Presse durch die Schliessung von FR und FTD aufgescheucht, die ZEIT vom 22.11. hat nicht nur ihren Leitartikel, sondern gleich auch noch vier Seiten im Wirtschaftsteil und eine Seite in Feuilleton dem Thema gewidmet.
Bereits in der Woche zuvor war der Gruner und Jahr Verlag im Wirtschaftsteil „Gruner ist gar“ einer Analyse unterzogen worden.
Irreführende Überschrift
Gleichwohl: Der Titel „Wie guter Journalismus überleben kann“ ist völlig irreführend. Denn es geht in dem Artikel nicht um das Überleben des guten Journalismus, sondern um das lukrative Überleben von Verlagen.

ZEIT vom 22.11.2012 ......irreführende Überschrift
Auch Axel Springer-Vorstand Döpfner und BILD-Chef Kai Diekmann wurden befragt, ein Verlag, der - jedenfalls mit seiner BILD und BILD am Sonntag - wohl kaum etwas mit gutem Journalismus zu tun hat.
Es wird zudem mit dem Titel impliziert, dass guter Journalismus nur in Verlagen, nicht jedoch anderswo, zu Hause sein kann. Das gilt aber nur für Printmedien mit dem dazugehörigen Aufwand in der Herstellung, nicht hingegen für das Internet, wo guter Journalismus – angesichts der minimalen Verbreitungskosten - mittlerweile auch in Blogs angetroffen werden kann.
Auch die notwendigen Werkzeuge, wie ein umfangreiches Archiv, sind dank Wikipedia und Google längst für jedermann verfügbar.
Andersherum: Es geht in dem genannten ZEIT-Artikel in Wahrheit schlicht und einfach darum: Wie können Verlage, die bisher mit Printausgaben märchenhafte Gewinne einfuhren, mit Print und Internet weiter Geld scheffeln.
Klar ist:
- ein kostenloses Internet bringt den Verlagen nicht genug ein, denn die Anzeigen haben sich grösstenteils von den Medien getrennt, und sind auf andere Plattformen abgewandert, z.B.Immobilienanzeigen.
ein kostenloses Internet bringt den Verlagen nicht genug ein, denn die Anzeigen haben sich grösstenteils von den Medien getrennt, und sind auf andere Plattformen abgewandert, z.B.Immobilienanzeigen.
 Die Herstellungs- und Verbreitungskosten im Internet – Hauptkostenfaktoren der Printmedien - sind ins nahezu Bodenlose gefallen, also fallen auch die Preise für Anzeigen drastisch, so sie überhaupt noch bei den Medienhäusern landen.
Die Herstellungs- und Verbreitungskosten im Internet – Hauptkostenfaktoren der Printmedien - sind ins nahezu Bodenlose gefallen, also fallen auch die Preise für Anzeigen drastisch, so sie überhaupt noch bei den Medienhäusern landen.
Nur bei extrem hohen Klickzahlen, wie Google und Facebook sie vorweisen, können hohe Anzeigenpreise durchgesetzt und Milliarden gescheffelt werden. Kein Wunder also, wenn einerseits das Anzeigenaufkommen für alle Printmedien drastisch gefallen ist, andererseits das Einkommen von deren Onlineauftritten aber insgesamt nur rund 200 Millionen Euro pro Jahr ausmachte, bei weitem kein Ausgleich!
Google verdient jährlich allein in Deutschland das Zehnfache: rund zwei Milliarden Euro.
Fieberhafte Suche
Also wird fieberhaft seitens der Medienhäuser nach Auswegen gesucht. Da die Werbekunden nicht gezwungen werden können zu inserieren, werden drei (Zwangs-)Massnahmen nun diskutiert, welche den Verlagen ihre Gewinne sichern sollen:
 1. Der Staat soll die Medienhäuser bezuschussen, subventionieren, jedenfalls deren Tageszeitungen, wie z. B. in Österreich, also letztlich der Steuerzahler zur Kasse gebeten werden.
1. Der Staat soll die Medienhäuser bezuschussen, subventionieren, jedenfalls deren Tageszeitungen, wie z. B. in Österreich, also letztlich der Steuerzahler zur Kasse gebeten werden.
 2. Der Internet-User soll direkt zahlen:
2. Der Internet-User soll direkt zahlen:
a) Entweder pro Anklicken oder über Abonnements,
b) Oder über seinen Serviceprovider, der ihm bestimmte Medien freischaltet und an die Medienhäuser im Gegenzug zahlt, letztendlich wieder der User über die dann erhöhte Flatrate.
 3. Google soll zahlen.
3. Google soll zahlen.
Google macht Milliardengewinne mit Werbung dank der extrem hohen Verbreitung (Klickzahlen).
Google, so sehen es die Verleger, soll den Verlagen im Prinzip das erstatten, was es den Medienhäusern an Werbung „abgenommen“ hat.
Verpackt wird das Ganze in ein Leistungsschutzrecht, das zur Zeit im Bundestag beraten wird. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um eine verkappte Umverteilungssteuer, da Google selbst nur auf die jeweiligen Medien verweist, aber selbst die Artikel gar nicht bringt.
Was wird sich ändern?
Variante 1: Umsetzung extrem unwahrscheinlich, da zur Zeit der Appetit auf weitere Subventionszahlungen nicht existiert.
Variante 2a: Ist bereits teilweise umgesetzt mit nur sehr, sehr mässigem Erfolg. Solange eine ausreichende Zahl an frei verfügbaren kostenlosen Internetangeboten besteht, wird sich daran auch nichts ändern. Deswegen drängt Springer-Chef Döpfner auf ein gemeinsames Vorgehen der Medienhäuser.
Variante 2b: Im Prinzip handelt es sich um eine Gebühr wie sie die GEZ für den öffentlich rechtlichen Rundfunk eintreibt. Dafür gibt es - zur Zeit jedenfalls - keine Mehrheiten.
Variante 3: Google will freiwillig nicht zahlen. Wenn das Gesetz, wie geplant, Google dazu zwingen sollte, dann könnte Google versucht sein, auf eigene Artikel oder auf Nachrichtenagenturen zu verweisen, wie AFP, dpa, dapd, Reuters, und mit denen Verträge abschliessen. Der Schuss könnte für etliche Medienhäuser dann auch noch nach hinten losgehen, weil kein Verweis auf ihre Produkte bei Google mehr zu finden ist.
Fazit:
Unterm Strich wird sich vorläufig wohl wenig ändern. Weitere Zeitungen werden dichtmachen, neue Internetangebote mit gutem Journalismus werden entstehen. Allerdings ist das alles für die von Schliessungen betroffenen Journalisten vorläufig noch keine ermutigende Nachricht.
Und das "Lex Google?" - Könnte scheitern
 Noch Zukunft für unabhängigen Qualitätsjournalismus der Printmedien?
Noch Zukunft für unabhängigen Qualitätsjournalismus der Printmedien?
 Frankfurter Rundschau – ein überregionales Traditionsblatt wird zur Regionalbeilage?
Frankfurter Rundschau – ein überregionales Traditionsblatt wird zur Regionalbeilage?
 Frankfurter Rundschau: "Kastration" als Überlebensprinzip
Frankfurter Rundschau: "Kastration" als Überlebensprinzip
 Krach in der Verlegerfamilie Neven DuMont oder: Ödipale Meuterei auf dem Schauberg?
Krach in der Verlegerfamilie Neven DuMont oder: Ödipale Meuterei auf dem Schauberg?
 Bodo Hombach und die Zukunft der Tageszeitungen - oder: Lokalteil hat Zukunft, WAZ macht Zukunft?
Bodo Hombach und die Zukunft der Tageszeitungen - oder: Lokalteil hat Zukunft, WAZ macht Zukunft?
 Umsonst ist nicht angemessen? - oder: Ist das Zeitungssterben aufzuhalten?
Umsonst ist nicht angemessen? - oder: Ist das Zeitungssterben aufzuhalten?
 Nach den Banken nun die Zeitungen?
Nach den Banken nun die Zeitungen?
 Gruner und Jahr Verlag: Trübe Aussichten, finanziell und journalistisch
Gruner und Jahr Verlag: Trübe Aussichten, finanziell und journalistisch
 Die neue Gruner und Jahr Story oder: Von Gruner und Jahr zu Anzeigen und Spar
Die neue Gruner und Jahr Story oder: Von Gruner und Jahr zu Anzeigen und Spar
 Der Fall Hypo Alpe-Adria (Skandalpe) – Eine Abschlussbetrachtung
Der Fall Hypo Alpe-Adria (Skandalpe) – Eine Abschlussbetrachtung
 Darfs ein bisschen weniger sein? Oder: Neues zum Niedergang des Qualitätsjournalismus
Darfs ein bisschen weniger sein? Oder: Neues zum Niedergang des Qualitätsjournalismus
 Josef Joffe und das Gespenst des drohenden Todes der Tageszeitungen
Josef Joffe und das Gespenst des drohenden Todes der Tageszeitungen
 Alles frei?– oder: Der Streit um das Urheberrecht und seine Vergütung
Alles frei?– oder: Der Streit um das Urheberrecht und seine Vergütung
Während eines Besuchs in Frankfurt im Juli 2012 fand ich auf Seite 2 und 3 einer Frankfurter Rundschau - das waren einstmals die Politik-Seiten, Seite 3 für politische Hintergrundartikel - einen Riesen-Artikel über „Amseln in der Grosstadt“.
Man brauchte kein Prophet zu sein, um zu konstatieren: das kann nicht gutgehen. Es ging auch nicht gut.
Die Frankfurter Rundschau war zu diesem Zeitpunkt journalistisch bereits kannibalisiert: die überregionalen Nachrichten und Analysen lieferte eine Zentralredaktion in Berlin, welche auch die anderen zum Kölner Verlag duMont-Schauberg gehörenden Blätter (Berliner Zeitung, Kölner Stadtanzeiger, Kölnische Rundschau, Mitteldeutsche Zeitung) journalistisch versorgte.
Jetzt also das vorläufige Ende einer grossen Nachkriegszeitung, linksliberal, ein Blatt, das auch die 68er Studentenbewegung und die Hausbesetzer kritisch, aber im Grundton wohlwollend begleitete. Und für diese Periode steht der Name Karl Gerold, der zusammen mit Arno Rudert (gestorben 1954) in Frankfurt Zeitungsgeschichte schrieb. Mit einem Blatt, das weit über Frankfurt hinaus hohes Ansehen genoss.
Einstmals Lizenz zum Gelddrucken
Drucklizenzen, nach dem Kriege von den Alliierten vergeben, waren de facto wie eine Lizenz zum Gelddrucken, das galt für alle Tageszeitungen, aber auch für Zeitschriften.
Der Hunger nach Informationen brachte die Käufer an die Kioske. Der Wirtschaftsaufschwung mit dem expandierenden Anzeigenmarkt spülte Geld in die Kassen der Verlage.. Und gerade der lokale ausserordentlich lukrative Anzeigenmarkt, den die Frankfurter Rundschau über Jahrzehnte dominierte, war ihre Haupteinnahmequelle.
Damit ist es vorbei. Viele Anzeigen sind mittlerweile ins Internet abgewandert, aber nur zu geringem Teil auf die Online-Auftritte der Tageszeitungen. Die neuesten Nachrichten sind ebenfalls im Internet zu finden, schneller als es die Tageszeitungen vermögen, sodass die Nachrichtenseiten in den Tageszeitungen mehr oder weniger den Schnee von gestern bringen.
Kein zwangsläufiges Ende
Das hätte keineswegs das Ende bedeuten müssen, denn es bleibt nach wie vor der Lokalteil, die tiefschürfenden Hintergrundanalysen, und der investigative Journalismus.
Allerdings braucht es dafür kompetente Journalisten, keine Content-Manager. Die Redaktion der FR wurde jedoch kannibalisiert, sodass zwar investigativ noch etwas ans Tageslicht gezerrt wurde, wie der Skandal um die hessischen Steuerfahnder, aber das alleine reichte nicht mehr.
Neben der Kannibalisierung auch das Fehlen von Konzepten und offenbares Missmanagement .
Auch Auflagen von Zeitschriften fallen
Auch Zeitschriften wie Stern und Brigitte hatten in den vergangenen Jahren deutliche Auflagenrückgänge hinzunehmen. Rückgänge, welche die jeweiligen Verlagen oftmals durch Einrichtung von Zentralredaktionen, also Personalkürzungen, beantworteten. Wir haben uns mehrfach damit beschäftigt.
Parallel dazu fingen Verlage wie Gruner und Jahr an, Firmenzeitschriften zu produzieren, deren Interessen zwangsläufig irgendwann auch mit investigativen journalistischen Recherchen anderer Printmedien kollidieren könnten, kollidieren müssen.
Nicht nur Frankfurter Rundschau
Mit der Nachricht über die Insolvenz der FR dann auch noch die Nachricht über das Ende der vor 12 Jahren gestarteten Financial Times Deutschland (FTD) . Eine Wirtschafts-Tageszeitung, journalistisch deutlich besser als das Handelsblatt, die aber eben keine Gewinne einfuhr sondern Jahr für Jahr Verluste machte. Also weg damit.
Guter Journalismus, der aber keine Gewinne einfährt, hat in einem Verlag wie Gruner und Jahr, der jährlich grosse Gewinne einfährt, mehrheitsmässig zur Betelsmann-Gruppe gehörend, nichts zu suchen.
Das war noch anders zu Zeiten von Gerd Bucerius, einst Mitbegründer des Verlages Gruner und Jahr, der den damaligen Spitzenjournalismus in der ZEIT jahrelang mit Gewinnen aus der Cash-Cow Stern finanzierte.
Nun ist die Presse durch die Schliessung von FR und FTD aufgescheucht, die ZEIT vom 22.11. hat nicht nur ihren Leitartikel, sondern gleich auch noch vier Seiten im Wirtschaftsteil und eine Seite in Feuilleton dem Thema gewidmet.
Bereits in der Woche zuvor war der Gruner und Jahr Verlag im Wirtschaftsteil „Gruner ist gar“ einer Analyse unterzogen worden.
Irreführende Überschrift
Gleichwohl: Der Titel „Wie guter Journalismus überleben kann“ ist völlig irreführend. Denn es geht in dem Artikel nicht um das Überleben des guten Journalismus, sondern um das lukrative Überleben von Verlagen.

ZEIT vom 22.11.2012 ......irreführende Überschrift
Auch Axel Springer-Vorstand Döpfner und BILD-Chef Kai Diekmann wurden befragt, ein Verlag, der - jedenfalls mit seiner BILD und BILD am Sonntag - wohl kaum etwas mit gutem Journalismus zu tun hat.
Es wird zudem mit dem Titel impliziert, dass guter Journalismus nur in Verlagen, nicht jedoch anderswo, zu Hause sein kann. Das gilt aber nur für Printmedien mit dem dazugehörigen Aufwand in der Herstellung, nicht hingegen für das Internet, wo guter Journalismus – angesichts der minimalen Verbreitungskosten - mittlerweile auch in Blogs angetroffen werden kann.
Auch die notwendigen Werkzeuge, wie ein umfangreiches Archiv, sind dank Wikipedia und Google längst für jedermann verfügbar.
Andersherum: Es geht in dem genannten ZEIT-Artikel in Wahrheit schlicht und einfach darum: Wie können Verlage, die bisher mit Printausgaben märchenhafte Gewinne einfuhren, mit Print und Internet weiter Geld scheffeln.
Klar ist:
-
Nur bei extrem hohen Klickzahlen, wie Google und Facebook sie vorweisen, können hohe Anzeigenpreise durchgesetzt und Milliarden gescheffelt werden. Kein Wunder also, wenn einerseits das Anzeigenaufkommen für alle Printmedien drastisch gefallen ist, andererseits das Einkommen von deren Onlineauftritten aber insgesamt nur rund 200 Millionen Euro pro Jahr ausmachte, bei weitem kein Ausgleich!
Google verdient jährlich allein in Deutschland das Zehnfache: rund zwei Milliarden Euro.
Fieberhafte Suche
Also wird fieberhaft seitens der Medienhäuser nach Auswegen gesucht. Da die Werbekunden nicht gezwungen werden können zu inserieren, werden drei (Zwangs-)Massnahmen nun diskutiert, welche den Verlagen ihre Gewinne sichern sollen:
a) Entweder pro Anklicken oder über Abonnements,
b) Oder über seinen Serviceprovider, der ihm bestimmte Medien freischaltet und an die Medienhäuser im Gegenzug zahlt, letztendlich wieder der User über die dann erhöhte Flatrate.
Google macht Milliardengewinne mit Werbung dank der extrem hohen Verbreitung (Klickzahlen).
Google, so sehen es die Verleger, soll den Verlagen im Prinzip das erstatten, was es den Medienhäusern an Werbung „abgenommen“ hat.
Verpackt wird das Ganze in ein Leistungsschutzrecht, das zur Zeit im Bundestag beraten wird. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um eine verkappte Umverteilungssteuer, da Google selbst nur auf die jeweiligen Medien verweist, aber selbst die Artikel gar nicht bringt.
Was wird sich ändern?
Variante 1: Umsetzung extrem unwahrscheinlich, da zur Zeit der Appetit auf weitere Subventionszahlungen nicht existiert.
Variante 2a: Ist bereits teilweise umgesetzt mit nur sehr, sehr mässigem Erfolg. Solange eine ausreichende Zahl an frei verfügbaren kostenlosen Internetangeboten besteht, wird sich daran auch nichts ändern. Deswegen drängt Springer-Chef Döpfner auf ein gemeinsames Vorgehen der Medienhäuser.
Variante 2b: Im Prinzip handelt es sich um eine Gebühr wie sie die GEZ für den öffentlich rechtlichen Rundfunk eintreibt. Dafür gibt es - zur Zeit jedenfalls - keine Mehrheiten.
Variante 3: Google will freiwillig nicht zahlen. Wenn das Gesetz, wie geplant, Google dazu zwingen sollte, dann könnte Google versucht sein, auf eigene Artikel oder auf Nachrichtenagenturen zu verweisen, wie AFP, dpa, dapd, Reuters, und mit denen Verträge abschliessen. Der Schuss könnte für etliche Medienhäuser dann auch noch nach hinten losgehen, weil kein Verweis auf ihre Produkte bei Google mehr zu finden ist.
Fazit:
Unterm Strich wird sich vorläufig wohl wenig ändern. Weitere Zeitungen werden dichtmachen, neue Internetangebote mit gutem Journalismus werden entstehen. Allerdings ist das alles für die von Schliessungen betroffenen Journalisten vorläufig noch keine ermutigende Nachricht.
Und das "Lex Google?" - Könnte scheitern
onlinedienst - 2. Dez, 17:31 Article 4181x read





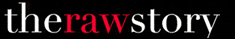

























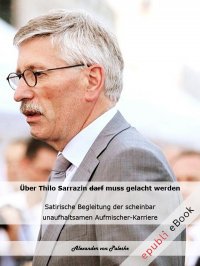

















Was ist bezweckt?
2. Bezogen auf die angeführten Punkte. Jedes Unternehmertum, dazu zählen auch die Medienhäuser, bewerkstelligt sein Gebiet auf eigenes Risiko - ob Gewinn oder Verlust, ob Stabilität und Behauptung oder Insolvenz. Es haftet hierfür kein anderes Unternehmen, keine andere Institution, ebenso nicht der Steuerzahler und in die Taschen eines Erfolgreichen (siehe Google) kann hier nicht gegriffen werden. Schaden frei halten auf Kosten anderer?
3. Hinter die Kulissen geschaut, entsteht bei einigen Medienhäusern der Eindruck, es war oder ist lediglich eine Art Vorteil-Hascherei - bezogen auf die verschiedenen Presseregelungen; d.h. nach außen Medien (Nutzen!) eigentlichen schon lange Zeit ein anderes Geschäft oder Investitionen in fremde Branchen, hervorstechend im Food-Bereich.