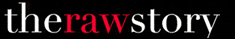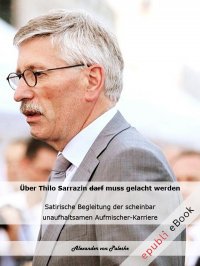Aussenluft muss man schnappen
Stephan FuchsDonal, bist du ein schreibender Traditionalist?
Donal McLaughlin: Wieso? So kann man das eigentlich nicht sagen. Weißt du, das... sagen wir mal "Hochenglische" wird in Schottland seit über zwanzig Jahren in Frage gestellt. Damals, anfangs der achtziger Jahre, war das ein harter Kampf um die Freiheit der eigenen Sprache, eben in den verschiedenen Formen von "Scots" zu schreiben. James Kelman, Alasdair Gray und Tom Leonard haben dabei den Anfang gemacht, das waren drei befreundete Autoren in Glasgow. Die haben es zu Beginn wirklich schwer gehabt, haben sich aber durchsetzen können. Das hat andere animiert, da weiter zu machen. Jüngere wie etwa Irvine Welsh, der dann auch mit Trainspotting einen Riesenerfolg hatte. Diese Art zu schreiben hat sich plötzlich durch das ganze Land verbreitet. Das fing in Glasgow an, kam dann nach Edinburgh im Osten Schottlands, bis rauf nach Aberdeen und in die Highlands. Immer mehr Schriftsteller entdeckten ihre Sprache wieder. Dann gibt’s aber auch Leute wie ich, irische Schotten, es gibt mittlerweile auch asiatische Schotten, italienische Schotten, die sich in den 90ern gesagt haben: Wir haben auch unsere Sprache, wir sind auch ein Teil von Schottland. Das war schon spannend.
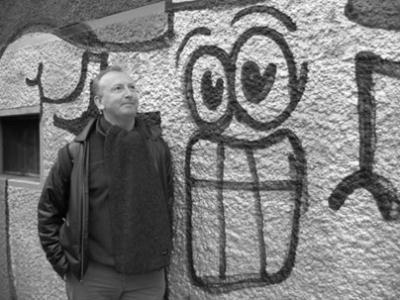
Es kommt auf dich selber an, was du mit Kultur machst. Der Trick ist der, dass du sie für dich überhaupt entdeckst, nicht?
War diese Bewegung denn ein bewusster Kampf gegen England, quasi eine schreibende Revolte?
Nicht unbedingt. Es ist auch so, dass gewisse Engländer inzwischen unsere Arbeit gesehen haben und längst begonnen haben, in ihrer Sprache zu schreiben...
...Cockney in London, zum Beispiel?
So ähnlich, ja. Ganz andere Stimmen wir sagen voices - werden jetzt gehört. Wenn das eine Revolte war, dann war das ein Kampf gegen...nun mal vereinfacht gesagt...Bloomsbury in London. Bloomsbury ist jener Stadtteil in London, wo all die grossen Buch- und Zeitungsverlage zuhause sind. Und Bloomsbury hat früher quasi bestimmt, was als Literatur gelten durfte und in welcher Sprache gelesen wurde. Schlussendlich entschied Bloomsbury, wer und was gelesen wird - und was nicht. Neben Bloomsbury konnte man früher auch Elite-Universitäten wie Oxford und Cambridge setzen. Wenn schottische Schriftsteller vor 20 Jahren einen Kampf führten, dann gegen diese Monopole - und nicht gegen England oder gar die Engländer. Die Bewegung, die keine war, zeigte, was man mit der "Sprache der Sprachlosen" machen kann und gab den angeblich Sprachlosen ihre Sprache zurück.
Wie übt Bloomsbury diese Macht aus?
Du, ich kann nicht sagen, ob das bewusst gesteuert wurde, dass unsere Literatur nicht publiziert wurde. Das wäre eine Unterstellung. Mittlerweile haben sie aber auch gemerkt, dass das, was in Schottland gemacht wird, allemal so interessant ist wie das, was aus London rauskommt. London verlegt auch längst die Schotten. Da ist schon etwas im Wandel. Trotzdem kann man nach wie vor kritisieren. Die grossen Verlage entscheiden nämlich, was man liest, indem sie sagen: Kurzgeschichten nein, Poesie auch nicht, aber Romane ja. Die Leser sehen das vielleicht anders, aber der Markt ist inzwischen König.
Ist denn deine Art zu schreiben nicht auch elitär, indem du für ein eigentlich kleines Publikum schreibst?
Nein, das sehe ich nicht so. Denn seit über 20 Jahren gehen wir bewusst raus aus den Universitäten etc. Die Schriftsteller gehen da hin, wo ganz normale Leute sind.
Und wie funktioniert das in der Schweiz?
Sagen wir mal so: Die erste Lesung, die ich in Zürich besucht habe, war ein Schock für mich. Man bezahlte 15 Franken Eintritt, und es war todernst. Mir ist auch aufgefallen, wie grau- bzw. weisshaarig das Publikum war. Die Veranstaltung war teuer. Für das Geld hätte ich, ich hab noch einen Freund eingeladen, mir doch das gebundene Buch kaufen können, oder?
In Schottland geht das anders?
Oh ja! Da sind vor allem alle Generationen vertreten. Da wird auch gelacht. Diskutiert. Da ist ein Prozess im Gang während einer Lesung. Die Leute kommen vor allem ins Gespräch. Anschliessend wird in der Kneipe weiter diskutiert. Der Veranstalter sagt auch an, wo.
Da kommen mir die Tränen vor Eifersucht. Da ist Literatur so, dass sie zugänglich gemacht werden kann.
Ich muss aber ehrlich sagen, hier in Bern hab ich das auch ansatzweise gesehen. Letztens hab ich z.B. in einem Atelier neben dem Rosengarten gelesen, da war auch die Fussball-EM-Übertragung. Da war das auch so. Die Leute kamen um gemeinsam Fussball zu kucken die Schweiz gegen Frankreich war’s. Man wusste: da wird noch gelesen und so kamen auch Leute extra dahin. Sie haben sich das angehört Fussballerisches von Beat Sterchi und mir. Wir haben Fussball geschaut, geredet und diskutiert. Geld? Es gab eine Kollekte, und die Leute gaben, was sie konnten oder wollten. Das war schon schön. Locker. So sollte Literatur sein. Öffentlich. Zugänglich. Erschwinglich.
Hat die Literatur-Bewegung auch die schottische Politik und die schottische Seele in Bezug auf ein eigenes Parlament und mehr Unabhängigkeit London gegenüber gestärkt?
Ja, auf jeden Fall. Das hat sich nahezu parallel entwickelt. Noch 1979 hatte es eine Umfrage gegeben, da sind aber viele Schotten nicht zur Urne gegangen. Meine älteren Kollegen beklagten sich damals auch viel darüber, dass London sie gar nicht hören wollte. Als Bürger und Schriftsteller hatten sie nichts zu melden gehabt. Da ihre Stimmen in der Politik nicht gehört wurden, begannen sie in den 80er Jahren, diese Stimmen zu Papier zu bringen. Auch andere Künstlerinnen haben in dieser Zeit auf die Kultur gesetzt. Filme, Bücher, Gedichte und Geschichten sind entstanden. Auch viel Musik. Die Autoren sind unter die Leute gegangen, sind raus aus den Institutionen, auch raus aus der Innenstadt, damit. Das war spannend. Man hat sich mit der eigenen Kultur wieder und ganz anders identifiziert. Kulturell gesehen wenn nicht in politischer Hinsicht war man unabhängig. Eine zweite Umfrage 1997 ist dann auch ganz anders ausgegangen...
Seit 1999 gibt es nun ja ein schottisches Parlament.
Genau. Und bei der Abstimmung wurde auch gefragt, ob die Bürger bereit wären, mehr Steuern für Schottland zu bezahlen. Das Resultat der beiden Abstimmungsfragen war ganz klar: Ja, wir wollen ein schottisches Parlament und ja, wir werden dafür mehr bezahlen.
Oh, das heisst was... Die Schotten gelten doch allgemein als geizig.
Ja, das war ein klares Signal an London. Wir sind bereit, drei Prozent mehr Steuern zu bezahlen um die eigene Politik auch umsetzen zu können. In punkto Bildungssystem, zum Beispiel. Oder Gesundheitsdienst. Das zeigt auch, dass es in Schottland noch eine linke Politik gibt, die sich von der angeblich linken Politik der Labour-Partei in England unterscheidet.
Trotzdem kennt man schottische Autoren, abgesehen von Irvine Welsh und nun Donal McLaughlin, nicht.
Du übertreibst, was meine Person angeht! Problematisch ist im Ausland vielleicht, dass man - wenn man schon von Engländern und von England spricht - alles in einen Topf wirft und Grossbritannien meint. Grossbritannien ist aber nicht England. Grossbritannien ist Wales, Schottland und England zusammen. Beim Vereinigten Königreich kommt Nordirland, wo ich geboren bin, dazu. Ich habe aber auch hier in Bern - in der Buchhandlung Stauffacher zum Beispiel - gesehen, dass es unzählige Schotten zu lesen gibt. Man erkennt sie bloss nicht als schottisch, sondern als britisch, bzw. englisch. Die Bücher sind auch ins deutsche übersetzt. Unter den Neuerscheinungen findest du momentan James Kelman und A L Kennedy zum Beispiel. Im Tessin hab ich sie sogar auf Italienisch gesehen. Fast alle Bücher von Bernard Mac Laverty waren vorhanden. Also du siehst, die Schotten sind da. Dazu kommt, dass ich in der NZZ und im Bund auch Buchbesprechungen hab lesen können. Und nicht zu vergessen: wer Ensuite in den letzten sechs Monaten gelesen hat, der kennt auch schon einige Schotten.
Schottland wie auch andere Länder sind ja aber schon ein klassisches Beispiel wie versucht wird die regionale Muttersprache zu unterbinden?
Ja, das ist wohl überall so. Bzw. war. In der Schule, zum Beispiel. Ältere Kollegen erzählen das und ich hab das zum Teil noch selber erlebt: Vorne stand der Lehrer, der alles zu wissen meinte und da sassen die Kinder oder Studenten die eigentlich Lust hatten, etwas zu lernen aber bloss nicht selbständig und kritisch werden sollten. Des Lehrers wirkliche Begabung war leider oft, einem die Literatur zu verderben. In Schottland wurde z.T. im Englisch-Unterricht terrorisiert. Man wurde früher offenbar geprügelt wenn man Scots sprach. Die Prügelstrafe galt bis in die achtziger Jahre. Lehrer hatten die Macht, das Wissen und wollten das oft für sich behalten. Da konnte man weniger Freude an der Literatur entdecken, es sei denn, man hatte das grosse Glück einen guten Lehrer zu erwischen...
Trotzdem hast du doktoriert...
....ach, das ist gar nicht wichtig. Wichtiger war: anders zu unterrichten, auch Literatur anders zu unterrichten. Anders auf die StudentInnen einzugehen. Ich bin aber vor 2 Jahren ausgestiegen. Durch Lesungen, Festivals usw. habe ich nun andere bessere Chancen, Literatur zu vermitteln, mich dafür einzusetzen.
Ist wahr. Was ich in den letzten sechs Monaten durch dich erfahren und gelernt habe, übertrifft bei weitem auch was mir meine Lehrer auf den Weg geben konnten. Danke Donal.
Du übertreibst wieder! Aber bitte... Literatur ist halt lebendig. Darauf kommt es mir an.
Es beeindruckt mich zu sehen, wie einerseits der Druck Richtung Globalisierung von allen Seiten vorwärts gepeitscht wird und die Literatur regionaler eben auch sprachlich sich etabliert. Ist das ein Gegenstrom der Sprachlosen?
Hmm, da muss man vorsichtig sein. Ich verstehe was du meinst, du hast auch Recht, aber es kommt noch dazu, dass das, was in Schottland passiert, keineswegs provinziell ist, sondern durchaus internationale Modelle hat. Klar, was Kelman in den 80ern gemacht hat, das war schon gegen Bloomsbury, gegen das Etablissement gerichtet. Sein Modell war aber z.T. die Literatur der Karibik. Auch Goethes Werther ist für Kelman sehr wichtig. Für mich persönlich sind deutschsprachige Autoren der Nachkriegszeit Andersch, Böll, Grass, auch Frisch und Dürrenmatt von grosser Bedeutung. Sich regional einzubunkern, das ist sicher nicht das Ziel, - und wir sind alles andere als provinziell. Es findet doch ein grosser und vielfältiger Austausch der Sprachen und Kulturen statt. Du siehst: wir sind keine Heimatdichter im engsten Sinne.
Und diese Literatur-Bewegung ist auch nicht auf dem Weg in die Isolation?
Bloss nicht, dadurch würden wir alle nur noch schwächer werden und wären so den Tendenzen von denen du sprichst, eher ausgesetzt. So hätte man noch weniger Chancen. Nein, das Regionale muss man mit dem Internationalen verbinden, wie ich das sehe. Aussenluft muss man schnappen. Sprachlich und kulturell gesehen ist die Schweiz da beispielhaft. Dieses Nebeneinander von Rätoromanisch, Italienisch, Französisch und Deutsch liebe ich. Dieses Sowohl-als-auch anstatt von Entweder-Oder. Dialekt ist auch längst radiofähig, tagesschaufähig, unifähig. In Schottland hingegen wurde man vor nicht allzu langer Zeit dafür geprügelt. Diesen Stellenwert gibt es bei uns noch immer nicht aber man tut wieder was dafür.
Ja gut, das hat ja auch einen geschichtlichen Hintergrund, die Schweiz wurde nie annektiert. Aber unser kulturelles Gut wird immer enger und kleiner.
Woran liegt das, meinst du?
Einer der Gründe ist vielleicht, dass Politiker Kultur für ihre Programme einverleiben. Allen voran Christoph Blocher, der es schafft schweizerische Urkultur mit dem Gütesiegel seiner Person oder seiner Partei zu besetzen. Das schreckt viele Leute ab, sich mit traditioneller Kultur und den Werten auseinander zu setzen. Man gilt dann schnell, vor allem bei jungen Menschen, als Patriot, was immer das dann wieder heisst.
Das fände ich sehr schade und problematisch. Während meines Aufenthaltes hab ich mir z.B. die grosse Hodler-Ausstellung in Zürich angeschaut, ich bin auf dem Weg der Schweiz gewandert - und ich gehe noch morgen auf das Rütli zu der Tell-Inszenierung. Für mich ist das jeweils eine Bereicherung. Eine Begegnung mit der Schweiz. Ich wusste gar nicht, dass diese von Blocher gesponsert werden.
Bravo, Donal. Das ist ja eigentlich ein Beweis hierfür, dass Kunst und Kultur eben unbelastet entdeckt werden und auch genossen werden kann. Kultur gehört ja dem Menschen und nicht der Politik.
Ja, es kommt auf dich selber an, was du mit Kultur machst. Der Trick ist der, dass du sie für dich überhaupt entdeckst, nicht? Und dabei kritisch und offen für anderes bleibst. Aber das ist bei uns genau dasselbe. Der Kilt, also der Schottenrock, die Volkslieder, Dudelsack, die irischen Lieder und so weiter - das war in meiner Jugend auch verpönt. Galt alles als lächerlich. Ich war genau so vorbelastet. Ich musste Irland neu entdecken und Schottland für mich entdecken. Perlen gibt’s nämlich, auch wenn klaro es auch Schwächeres gibt. Inzwischen habe ich ein ganz anderes Verhältnis zu meinen kulturellen Wurzeln. Das ist ein Teil meines Lebens. In dem Sinne kann man sagen: ein Blocher blockiert nur, wenn man das zulässt.
"Blocher blockiert" ist wunderbar! Vielleicht hast du damit einigen Lesern Mut gegeben, sich ihre Kultur und ihre Heimat Zurückzugewinnen. Donal, an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz persönlich für wundervolle sechs Monate bedanken. Ich glaube, du hast Bern und den Lesern deiner Beiträge ein Fenster nach Schottland und neuer Ideen geöffnet. Bis bald, Donal, wir freuen uns...
Donal McLaughlin ist gebürtiger Nordirländer, lebt aber seit 34 Jahren in Schottland. Er ist als Autor, Übersetzer/Dolmetscher & Herausgeber tätig. McLaughlin ist seit Februar 2004 der erste Scottish Writing Fellow der Stadt Bern.
Donal McLaughlin: Wieso? So kann man das eigentlich nicht sagen. Weißt du, das... sagen wir mal "Hochenglische" wird in Schottland seit über zwanzig Jahren in Frage gestellt. Damals, anfangs der achtziger Jahre, war das ein harter Kampf um die Freiheit der eigenen Sprache, eben in den verschiedenen Formen von "Scots" zu schreiben. James Kelman, Alasdair Gray und Tom Leonard haben dabei den Anfang gemacht, das waren drei befreundete Autoren in Glasgow. Die haben es zu Beginn wirklich schwer gehabt, haben sich aber durchsetzen können. Das hat andere animiert, da weiter zu machen. Jüngere wie etwa Irvine Welsh, der dann auch mit Trainspotting einen Riesenerfolg hatte. Diese Art zu schreiben hat sich plötzlich durch das ganze Land verbreitet. Das fing in Glasgow an, kam dann nach Edinburgh im Osten Schottlands, bis rauf nach Aberdeen und in die Highlands. Immer mehr Schriftsteller entdeckten ihre Sprache wieder. Dann gibt’s aber auch Leute wie ich, irische Schotten, es gibt mittlerweile auch asiatische Schotten, italienische Schotten, die sich in den 90ern gesagt haben: Wir haben auch unsere Sprache, wir sind auch ein Teil von Schottland. Das war schon spannend.
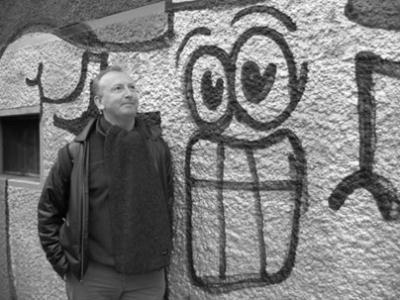
Es kommt auf dich selber an, was du mit Kultur machst. Der Trick ist der, dass du sie für dich überhaupt entdeckst, nicht?
War diese Bewegung denn ein bewusster Kampf gegen England, quasi eine schreibende Revolte?
Nicht unbedingt. Es ist auch so, dass gewisse Engländer inzwischen unsere Arbeit gesehen haben und längst begonnen haben, in ihrer Sprache zu schreiben...
...Cockney in London, zum Beispiel?
So ähnlich, ja. Ganz andere Stimmen wir sagen voices - werden jetzt gehört. Wenn das eine Revolte war, dann war das ein Kampf gegen...nun mal vereinfacht gesagt...Bloomsbury in London. Bloomsbury ist jener Stadtteil in London, wo all die grossen Buch- und Zeitungsverlage zuhause sind. Und Bloomsbury hat früher quasi bestimmt, was als Literatur gelten durfte und in welcher Sprache gelesen wurde. Schlussendlich entschied Bloomsbury, wer und was gelesen wird - und was nicht. Neben Bloomsbury konnte man früher auch Elite-Universitäten wie Oxford und Cambridge setzen. Wenn schottische Schriftsteller vor 20 Jahren einen Kampf führten, dann gegen diese Monopole - und nicht gegen England oder gar die Engländer. Die Bewegung, die keine war, zeigte, was man mit der "Sprache der Sprachlosen" machen kann und gab den angeblich Sprachlosen ihre Sprache zurück.
Wie übt Bloomsbury diese Macht aus?
Du, ich kann nicht sagen, ob das bewusst gesteuert wurde, dass unsere Literatur nicht publiziert wurde. Das wäre eine Unterstellung. Mittlerweile haben sie aber auch gemerkt, dass das, was in Schottland gemacht wird, allemal so interessant ist wie das, was aus London rauskommt. London verlegt auch längst die Schotten. Da ist schon etwas im Wandel. Trotzdem kann man nach wie vor kritisieren. Die grossen Verlage entscheiden nämlich, was man liest, indem sie sagen: Kurzgeschichten nein, Poesie auch nicht, aber Romane ja. Die Leser sehen das vielleicht anders, aber der Markt ist inzwischen König.
Ist denn deine Art zu schreiben nicht auch elitär, indem du für ein eigentlich kleines Publikum schreibst?
Nein, das sehe ich nicht so. Denn seit über 20 Jahren gehen wir bewusst raus aus den Universitäten etc. Die Schriftsteller gehen da hin, wo ganz normale Leute sind.
Und wie funktioniert das in der Schweiz?
Sagen wir mal so: Die erste Lesung, die ich in Zürich besucht habe, war ein Schock für mich. Man bezahlte 15 Franken Eintritt, und es war todernst. Mir ist auch aufgefallen, wie grau- bzw. weisshaarig das Publikum war. Die Veranstaltung war teuer. Für das Geld hätte ich, ich hab noch einen Freund eingeladen, mir doch das gebundene Buch kaufen können, oder?
In Schottland geht das anders?
Oh ja! Da sind vor allem alle Generationen vertreten. Da wird auch gelacht. Diskutiert. Da ist ein Prozess im Gang während einer Lesung. Die Leute kommen vor allem ins Gespräch. Anschliessend wird in der Kneipe weiter diskutiert. Der Veranstalter sagt auch an, wo.
Da kommen mir die Tränen vor Eifersucht. Da ist Literatur so, dass sie zugänglich gemacht werden kann.
Ich muss aber ehrlich sagen, hier in Bern hab ich das auch ansatzweise gesehen. Letztens hab ich z.B. in einem Atelier neben dem Rosengarten gelesen, da war auch die Fussball-EM-Übertragung. Da war das auch so. Die Leute kamen um gemeinsam Fussball zu kucken die Schweiz gegen Frankreich war’s. Man wusste: da wird noch gelesen und so kamen auch Leute extra dahin. Sie haben sich das angehört Fussballerisches von Beat Sterchi und mir. Wir haben Fussball geschaut, geredet und diskutiert. Geld? Es gab eine Kollekte, und die Leute gaben, was sie konnten oder wollten. Das war schon schön. Locker. So sollte Literatur sein. Öffentlich. Zugänglich. Erschwinglich.
Hat die Literatur-Bewegung auch die schottische Politik und die schottische Seele in Bezug auf ein eigenes Parlament und mehr Unabhängigkeit London gegenüber gestärkt?
Ja, auf jeden Fall. Das hat sich nahezu parallel entwickelt. Noch 1979 hatte es eine Umfrage gegeben, da sind aber viele Schotten nicht zur Urne gegangen. Meine älteren Kollegen beklagten sich damals auch viel darüber, dass London sie gar nicht hören wollte. Als Bürger und Schriftsteller hatten sie nichts zu melden gehabt. Da ihre Stimmen in der Politik nicht gehört wurden, begannen sie in den 80er Jahren, diese Stimmen zu Papier zu bringen. Auch andere Künstlerinnen haben in dieser Zeit auf die Kultur gesetzt. Filme, Bücher, Gedichte und Geschichten sind entstanden. Auch viel Musik. Die Autoren sind unter die Leute gegangen, sind raus aus den Institutionen, auch raus aus der Innenstadt, damit. Das war spannend. Man hat sich mit der eigenen Kultur wieder und ganz anders identifiziert. Kulturell gesehen wenn nicht in politischer Hinsicht war man unabhängig. Eine zweite Umfrage 1997 ist dann auch ganz anders ausgegangen...
Seit 1999 gibt es nun ja ein schottisches Parlament.
Genau. Und bei der Abstimmung wurde auch gefragt, ob die Bürger bereit wären, mehr Steuern für Schottland zu bezahlen. Das Resultat der beiden Abstimmungsfragen war ganz klar: Ja, wir wollen ein schottisches Parlament und ja, wir werden dafür mehr bezahlen.
Oh, das heisst was... Die Schotten gelten doch allgemein als geizig.
Ja, das war ein klares Signal an London. Wir sind bereit, drei Prozent mehr Steuern zu bezahlen um die eigene Politik auch umsetzen zu können. In punkto Bildungssystem, zum Beispiel. Oder Gesundheitsdienst. Das zeigt auch, dass es in Schottland noch eine linke Politik gibt, die sich von der angeblich linken Politik der Labour-Partei in England unterscheidet.
Trotzdem kennt man schottische Autoren, abgesehen von Irvine Welsh und nun Donal McLaughlin, nicht.
Du übertreibst, was meine Person angeht! Problematisch ist im Ausland vielleicht, dass man - wenn man schon von Engländern und von England spricht - alles in einen Topf wirft und Grossbritannien meint. Grossbritannien ist aber nicht England. Grossbritannien ist Wales, Schottland und England zusammen. Beim Vereinigten Königreich kommt Nordirland, wo ich geboren bin, dazu. Ich habe aber auch hier in Bern - in der Buchhandlung Stauffacher zum Beispiel - gesehen, dass es unzählige Schotten zu lesen gibt. Man erkennt sie bloss nicht als schottisch, sondern als britisch, bzw. englisch. Die Bücher sind auch ins deutsche übersetzt. Unter den Neuerscheinungen findest du momentan James Kelman und A L Kennedy zum Beispiel. Im Tessin hab ich sie sogar auf Italienisch gesehen. Fast alle Bücher von Bernard Mac Laverty waren vorhanden. Also du siehst, die Schotten sind da. Dazu kommt, dass ich in der NZZ und im Bund auch Buchbesprechungen hab lesen können. Und nicht zu vergessen: wer Ensuite in den letzten sechs Monaten gelesen hat, der kennt auch schon einige Schotten.
Schottland wie auch andere Länder sind ja aber schon ein klassisches Beispiel wie versucht wird die regionale Muttersprache zu unterbinden?
Ja, das ist wohl überall so. Bzw. war. In der Schule, zum Beispiel. Ältere Kollegen erzählen das und ich hab das zum Teil noch selber erlebt: Vorne stand der Lehrer, der alles zu wissen meinte und da sassen die Kinder oder Studenten die eigentlich Lust hatten, etwas zu lernen aber bloss nicht selbständig und kritisch werden sollten. Des Lehrers wirkliche Begabung war leider oft, einem die Literatur zu verderben. In Schottland wurde z.T. im Englisch-Unterricht terrorisiert. Man wurde früher offenbar geprügelt wenn man Scots sprach. Die Prügelstrafe galt bis in die achtziger Jahre. Lehrer hatten die Macht, das Wissen und wollten das oft für sich behalten. Da konnte man weniger Freude an der Literatur entdecken, es sei denn, man hatte das grosse Glück einen guten Lehrer zu erwischen...
Trotzdem hast du doktoriert...
....ach, das ist gar nicht wichtig. Wichtiger war: anders zu unterrichten, auch Literatur anders zu unterrichten. Anders auf die StudentInnen einzugehen. Ich bin aber vor 2 Jahren ausgestiegen. Durch Lesungen, Festivals usw. habe ich nun andere bessere Chancen, Literatur zu vermitteln, mich dafür einzusetzen.
Ist wahr. Was ich in den letzten sechs Monaten durch dich erfahren und gelernt habe, übertrifft bei weitem auch was mir meine Lehrer auf den Weg geben konnten. Danke Donal.
Du übertreibst wieder! Aber bitte... Literatur ist halt lebendig. Darauf kommt es mir an.
Es beeindruckt mich zu sehen, wie einerseits der Druck Richtung Globalisierung von allen Seiten vorwärts gepeitscht wird und die Literatur regionaler eben auch sprachlich sich etabliert. Ist das ein Gegenstrom der Sprachlosen?
Hmm, da muss man vorsichtig sein. Ich verstehe was du meinst, du hast auch Recht, aber es kommt noch dazu, dass das, was in Schottland passiert, keineswegs provinziell ist, sondern durchaus internationale Modelle hat. Klar, was Kelman in den 80ern gemacht hat, das war schon gegen Bloomsbury, gegen das Etablissement gerichtet. Sein Modell war aber z.T. die Literatur der Karibik. Auch Goethes Werther ist für Kelman sehr wichtig. Für mich persönlich sind deutschsprachige Autoren der Nachkriegszeit Andersch, Böll, Grass, auch Frisch und Dürrenmatt von grosser Bedeutung. Sich regional einzubunkern, das ist sicher nicht das Ziel, - und wir sind alles andere als provinziell. Es findet doch ein grosser und vielfältiger Austausch der Sprachen und Kulturen statt. Du siehst: wir sind keine Heimatdichter im engsten Sinne.
Und diese Literatur-Bewegung ist auch nicht auf dem Weg in die Isolation?
Bloss nicht, dadurch würden wir alle nur noch schwächer werden und wären so den Tendenzen von denen du sprichst, eher ausgesetzt. So hätte man noch weniger Chancen. Nein, das Regionale muss man mit dem Internationalen verbinden, wie ich das sehe. Aussenluft muss man schnappen. Sprachlich und kulturell gesehen ist die Schweiz da beispielhaft. Dieses Nebeneinander von Rätoromanisch, Italienisch, Französisch und Deutsch liebe ich. Dieses Sowohl-als-auch anstatt von Entweder-Oder. Dialekt ist auch längst radiofähig, tagesschaufähig, unifähig. In Schottland hingegen wurde man vor nicht allzu langer Zeit dafür geprügelt. Diesen Stellenwert gibt es bei uns noch immer nicht aber man tut wieder was dafür.
Ja gut, das hat ja auch einen geschichtlichen Hintergrund, die Schweiz wurde nie annektiert. Aber unser kulturelles Gut wird immer enger und kleiner.
Woran liegt das, meinst du?
Einer der Gründe ist vielleicht, dass Politiker Kultur für ihre Programme einverleiben. Allen voran Christoph Blocher, der es schafft schweizerische Urkultur mit dem Gütesiegel seiner Person oder seiner Partei zu besetzen. Das schreckt viele Leute ab, sich mit traditioneller Kultur und den Werten auseinander zu setzen. Man gilt dann schnell, vor allem bei jungen Menschen, als Patriot, was immer das dann wieder heisst.
Das fände ich sehr schade und problematisch. Während meines Aufenthaltes hab ich mir z.B. die grosse Hodler-Ausstellung in Zürich angeschaut, ich bin auf dem Weg der Schweiz gewandert - und ich gehe noch morgen auf das Rütli zu der Tell-Inszenierung. Für mich ist das jeweils eine Bereicherung. Eine Begegnung mit der Schweiz. Ich wusste gar nicht, dass diese von Blocher gesponsert werden.
Bravo, Donal. Das ist ja eigentlich ein Beweis hierfür, dass Kunst und Kultur eben unbelastet entdeckt werden und auch genossen werden kann. Kultur gehört ja dem Menschen und nicht der Politik.
Ja, es kommt auf dich selber an, was du mit Kultur machst. Der Trick ist der, dass du sie für dich überhaupt entdeckst, nicht? Und dabei kritisch und offen für anderes bleibst. Aber das ist bei uns genau dasselbe. Der Kilt, also der Schottenrock, die Volkslieder, Dudelsack, die irischen Lieder und so weiter - das war in meiner Jugend auch verpönt. Galt alles als lächerlich. Ich war genau so vorbelastet. Ich musste Irland neu entdecken und Schottland für mich entdecken. Perlen gibt’s nämlich, auch wenn klaro es auch Schwächeres gibt. Inzwischen habe ich ein ganz anderes Verhältnis zu meinen kulturellen Wurzeln. Das ist ein Teil meines Lebens. In dem Sinne kann man sagen: ein Blocher blockiert nur, wenn man das zulässt.
"Blocher blockiert" ist wunderbar! Vielleicht hast du damit einigen Lesern Mut gegeben, sich ihre Kultur und ihre Heimat Zurückzugewinnen. Donal, an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz persönlich für wundervolle sechs Monate bedanken. Ich glaube, du hast Bern und den Lesern deiner Beiträge ein Fenster nach Schottland und neuer Ideen geöffnet. Bis bald, Donal, wir freuen uns...
Donal McLaughlin ist gebürtiger Nordirländer, lebt aber seit 34 Jahren in Schottland. Er ist als Autor, Übersetzer/Dolmetscher & Herausgeber tätig. McLaughlin ist seit Februar 2004 der erste Scottish Writing Fellow der Stadt Bern.
sfux - 5. Jan, 23:11 Article 1643x read